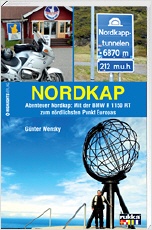Panamericana-Tour - Leseprobe
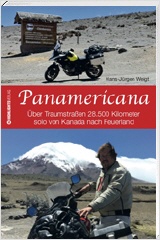
Kampfbereit
Zunächst geht es noch ein Stück durch den kargen, kakteenbestandenen Norden Mexikos. Hinter der Brücke über den Rio Grande ist man schon mitten im „Schurkenland“. Das merkt man, ohne die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes gelesen zu haben. Die schwarz-weißen Pickups der mexikanischen Bundespolizei, der Federales, haben Maschinengewehre mit Kugelschutz über der abgedunkelten Fahrerkabine. Dahinter stehen neben dem Schützen zwei weitere vermummte Uniformierte. So patrouillieren sie auf den Landstraßen ebenso wie in der Innenstadt der Millionenstadt Monterrey.
Ähnlich, nur in olivgrün, ist das Militär unterwegs. Auf der Fahrt entlang der Karibikküste steht in Veracruz neben jedem Tankwart ein bewaffneter Wächter. In Guatemala und El Salvador sitzen Aufpasser mit einer Pumpgun und acht Schuss Schrotmunition im Gürtel an der Tür zum Burger-Restaurant. In Nicaragua tragen die Wächter die etwas veraltete AK 47 von Kalashnikov. In Tegucigalpa, der Hauptstadt von Honduras, wirkt die Szenerie nur unwesentlich entspannter. Hier reichen der Polizei Pistolen am Gürtel. Die privaten Wächter an Tankstellen und Banken tragen statt der Gewehre Elektro-Teaser.
Sogar in Costa Rica, das offiziell keine Armee hat und von Tourismus-Werbern gerne als die „Schweiz Mittelamerikas“ gepriesen wird, sind die Privathäuser mit hohen Stahltoren und Stacheldraht verbarrikadiert. Nachtwächter bewachen die Tore vor den einfachen wie exklusiveren Unterkünften der Touristen. Erst in Panama ändert sich das Bild, werden Wachmänner und Mauern weniger. Dafür kontrolliert dort die Polizei besonders häufig mit Straßensperren.
Vorteil der vielen Wachleute für Motorradreisende: Die Maschine kann gut beaufsichtigt abgestellt werden. Die Wachleute sind aufmerksam und ich habe nicht einmal den Versuch erlebt, die Tasche auf dem Gepäckträger wegzunehmen oder die Aluminiumpacktaschen aufzubrechen. Allerdings habe ich die Maschine bei Rasthäusern und Bankautomaten immer in Sichtweite geparkt und bei Hotels und Sehenswürdigkeiten stand sie auf bewachten Parkplätzen oder am Eingang.
Zweimal war die Situation allerdings unübersichtlich. Eine davon war wohl ein Überfallversuch mit Macheten.
Holpriger Start in Lateinamerika
Eine Spezialität der mexikanischen Straßenplaner sind die Schwellen, die in den Asphalt eingearbeitet werden. Es gibt offensichtlich dafür keine DIN-Norm. Mal ist es nur ein sanfter Holperer, meistens aber türmt sich der Teer bis zum Straßenrand. Manche sind schmal und hoch, andere einen halben Meter breit mit ordentlicher schräger Auffahrt. Gelegentlich sind schmale Durchfahrten für Mopedreifen eingearbeitet. Oft haben die Mopeds der Einheimischen Fahrspuren neben dem Teerstreifen gefunden. Bremsen muß man auf jeden Fall. Richtig unangenehm werden die „Taupas“ genannten Schwellen, wenn sie so hoch sind, daß der Motorschutz der Enduro aufsetzt. Das Bike wird regelrecht ausgehebelt. Das Hinterrad dreht durch. Eine andere Spezialität sind Taupas auf vermeintlich freier Strecke. Hinter Kuppen oder mitten im Wald. Wenn man im letzten Moment in die Eisen geht, dann kurz die Dämpfung freigibt und über die Schwellen fliegt, fällt der Blick oft auf die Einfahrt zur Kaserne irgendeines Infanterie-Bataillons oder eines Luftwaffenstützpunktes, auf dem ein paar alte Huey-Helikopter vor sich hin rosten.
In Mexiko sind die Schwellen vielfältig, häufig und schlicht nervig wie in keinem anderen lateinamerikanischen Land. Für die vielen Hütten der Reifenhändler entlang der Straßen sind sie ein Konjunkturprogramm. Immer wieder sieht man Autos am Straßenrand mit geplatzten Reifen oder abgerissener Aufhängung. Die Lastwagen rollen im ersten Gang über die Schwellen, die in machen Ortsdurchfahrten alle 50 Meter verbaut sind. Gute Stellen, um die Lastwagen zu überholen, wenn der Gegenverkehr es zulässt und einem nicht gerade Obst-, Sonnenbrillen- oder Limonadenverkäufer vors Vorderrad laufen, die überall in Lateinamerika, wo der Verkehr etwas langsamer fließt, versuchen, ein paar Centavos zu verdienen.
Mexiko hat eine moderne Infrastruktur, große, lebhafte Stadtzentren und viele amerikanische Einflüsse. Auf dem Weg von Monterrey nach Tampico grüßt die Werbung von „Coyote Harley Davidson“ im ausgedehnten Industriegerät am Stadtrand. In den Häfen am Golf riecht es nach Bitumen. Ausgedehnte Raffinerien verarbeiten das Öl, das auf den Plattformen vor der Küste gefördert wird. In Tampico, Veracruz und Ciudad Carmen stehen moderne Strandhotels mit Blick auf die Förderanlagen. Abseits der bewachten Abschnitte sind nur selten Touristen unterwegs. Wenn es dunkel wird, leeren sich die Stadtzentren und Strandstraßen schnell. Das Leben spielt sich, wenn überhaupt, nur in den bewachten Hotels und Restaurants ab.
2000 Kilometer fahre ich durchs Land von Zorro und Speedy Gonzales. Es gab einige nette Ortschaften, Bergseen und Strände. Um die Hauptstadt mit ihren 20 Millionen Einwohnern habe ich einen großen Bogen gemacht. Irgendwie wirkt das sonnige Land träge, uninspiriert. Und an die vielen schwer bewaffneten Sicherheitsleute, die südlich der USA überall an Fastfood-Restaurants, Parkplätzen, Hotels und Tankstellen herumstehen, kann ich mich nur schwer gewöhnen.
Besonders berüchtigt ist Veracruz. Ich hatte mich beim Tanken schon gewundert, daß neben je zwei Tanksäulen ein Tankwart stand und neben jedem der beiden Tankwarte ein Bewaffneter. Mit kugelsicherer Weste bei 35 Grad und 99 Prozent Luftfeuchtigkeit und einer Pumpgun auf dem Unterarm schützen sie zu zweit die Spritstation.
Die große Hafenstadt an der Ostküste wurde schon zu Zeiten der spanischen Kolonisatoren Mexikos Tor in die Karibik und nach Europa. Die Hochseeschiffe legen noch immer direkt im Stadtzentrum von Veracruz an. Touristen bummeln über die restaurierten Promenaden und Plätze. Doch hinter der schmucken historischen Fassade tobt der Krieg der Drogenschmuggler.
Hamid klärt mich auf. Er ist ein waschechter katholischer Mexikaner, geboren in Veracruz. Seine Eltern haben ihm den arabisch klingenden Namen gegeben, weil es schon so viele Pedros und Juans in der Nachbarschaft gab. Der Messtechnik-Spezialist aus Mexico City ist auf Geschäftsreise, als wir uns zufällig unterwegs treffen. Mit dem Motorrad war ich in seiner Geburtsstadt? Er blickt mich zweifelnd an. Mit seiner 1200er Ténéré, die er in Mexico City für Wochenendausflüge nutzt, würde er niemals dort hinfahren. Viel zu gefährlich.
Später beim Bier erklärt er, warum. Die Drogen kommen über Mittelamerika an den Golf von Mexiko. Von Veracruz aus werden sie dann über See-, Luft- und Landwege nach Norden in die Vereinigten Staaten gebracht. Wer den Verkehrsknotenpunkt kontrolliert, macht das Geschäft. Deshalb kämpfen die Drogenbanden hier noch heftiger als in vielen anderen Gegenden Zentralamerikas um ihre Reviere.
Die schwer bewaffneten Pickups der „Federales“, der Bundespolizei und der Sondereinheiten des Militärs, begegnen einem aber nicht nur in den Großstädten wie Monterrey oder Tampico. Auch auf den Landstraßen und während der Fahrt durch die Dschungel Yucatans sind sie unterwegs. Aber ein Bewaffneter pro Tankwart – mit der Quote ist Veracruz Spitze.
Versunkene Städte, fehlender Stempel
Unter 50 Meter hohen Bäumen liegen die steinernen Zeugen der Hochkulturen, die vor der Ankunft der Spanier in weiten Teilen Mexikos blühten. In Stufen steil ansteigende Pyramiden, gepflasterte Wege, Wohnhäuser, Paläste, Festungen. Azteken, Mayas und viele kleinere Völker schlossen Städtebünde, fochten Kriege und opferten ihren Göttern Menschen und Tiere. Die Wälder und Berge Mittelamerikas sind voller steinerner Bauten der Völker, die hier in präkolumbianischer Zeit lebten.
Die Ruinenstadt Calakmul liegt an der Straße durch das gleichnamige Biosphären-Reservat. Am Eingang zu dem Areal ist ein kleiner Eintrittspreis zu zahlen, dann ist man allein zwischen zugewachsenen Steinwänden und schmalen Pfaden. Noch kann man überall herumklettern. Während des einstündigen Rundgangs begegnen mir keine zehn Besucher. Die Motorradstiefel geben das trügerische Gefühl, vor den Schlangen und Skorpionen geschützt zu sein, die zwischen den Steinen leben.
Calakmul ist eine von hunderten Mayastädten auf der Halbinsel von Yucatan. Bis in den Norden von Honduras siedelte das Volk. Der Niedergang der Zivilisation begann schon Jahrhunderte vor Ankunft der Europäer. Ein Grund: Klimawandel. Vor 1200 Jahren vernichteten nach den Erkenntnissen der Archäologen geringerer Niederschlag, Trockenheit und Überbevölkerung die wirtschaftliche Grundlage vieler Maya-Siedlungen im Tiefland von Yucatan.
Bei der Ausreise nach Belize wundert sich der Zöllner, dass ich keine Einreisestempel für Mensch und Maschine habe. Ich bin ja 2000 Kilometer zuvor im Verkehrsstrom über die Brücke am Rio Grande von Texas nach Nuevo Laredo gespült worden. Niemand interessierte sich für das gelbe Motorrad auf dem Weg nach Süden, während Richtung USA eine mehrspurige Autokolonne stand. Und ich hatte kein Interesse, mich stundenlang der gleißenden Sonne und den möglichen Fragen der Grenzer dort auszusetzen. Also bin ich weiter gefahren, um nun am Rio Hondo anzukommen, dem Grenzfluß am nordöstlichen Ende Mexikos.
Nach einigen Minuten Palaver zahle ich die üblichen 30 Dollar Zollgebühr. Er gibt sich mit dem amerikanischen Einreisestempel von der kanadischen Grenze zufrieden. Der ist vier Wochen alt. Ich werde also die erlaubten drei Monate im Lande nicht überzogen haben. Ein versöhnlicher Abschied vom Land der Taupas.
Unterwegs bei den Bay People in Belize
„Ok. You get seven days.“ Die Zöllnerin gibt sich resolut. Ein- bis zwei Wochen wollte ich in Belize unterwegs sein. Sie nimmt die untere Grenze der Spanne. „Willkommen“ in einem der unbekanntesten Länder der Welt.
500 Kilometer Teerstraße verbinden die Hauptorte des einzigen mittelamerikanischen Landes, in dem Englisch und nicht Spanisch gesprochen wird. „So groß wie Hessen“ ist die Welt, die sich mir nun für Motorradtouren öffnet, nach der Beschreibung diverser Reiseführer. Also etwa von Kassel bis zum Hockenheimring. Allerdings wohnen hier nur halb soviel Leute wie in Frankfurt, etwa 350.000.
Auf meinem Weg von Kanada nach Feuerland habe ich einen Abstecher von der Panamericana gemacht. Wann ist man schon mal mit dem eigenen Bike in dieser Gegend? Belize ist so klein und abgelegen, dass es in die Planungen der Fernstraße, die die Staaten Nord- und Südamerikas verbinden sollte, gar nicht einbezogen wurde. Heute führt eine lange Straße durch den Dschungel Yucatans an die mexikanische Grenze zu Belize. Weiter südlich kann man dann nach Guatemala weiterfahren. Einen inoffiziellen Grenzübergang gibt es noch ganz im Süden des Landes. Der ist allerdings schlecht befahrbar, man kommt illegal in Guatemala an und kann unterwegs unangenehme Erfahrungen mit Drogen- und Waffenschmugglern machen.
Da ich auf meiner Panamericana-Tour noch einige der 25.000 Kilometer nach Ushuaia vor mir habe und genug Abenteuer warten, plane ich die legale Reiseroute: Von Mexiko nach Belize City, ein paar Tage am Strand und weiter über Belmopan nach Guatemala, damit lernt man den größeren Teil des geteerten Straßennetzes und die meisten Orte kennen, dazu die einzigen beiden offiziellen Grenzübergänge aus dem Land, das einst als Schurkenstaat für die Unterbringung arbeitslos gewordener Seeräuber gegründet wurde.
Noch heute haben die Bay People große Sorgen, dass einer der beiden Nachbarstaaten sich das dünn besiedelte Gebiet einverleibt. Vor allem Guatemala werden seit der Unabhängigkeit 1981 entsprechende Ambitionen nachgesagt. Immer wieder kam es zu Verhandlungen mit dem großen Nachbarn, ohne dass dieser bisher auf seine Gebietsansprüche im Westen des Landes verzichtet hat.
Das Verteidigungsministerium von Belize liegt in der Hauptstadt Belmopan gleich neben der Bäckerei und ist so überschaubar wie die gesamten Streitkräfte des Landes. Allerdings wird die kleine Streitmacht von den Soldaten der ehemaligen britischen Kolonialherren noch ordentlich trainiert. Gegen die putscherprobten Militärs des 17 Millionen-Volkes von Guatemala hätten sie wohl dennoch einen schweren Stand.
Vielvölkergemisch
Am Grenzübergang fallen die vielen neuen Samsonite-Koffer auf, die neben meinen beiden Innen-Packtaschen und der regendichten Tasche vom Gepäckträger liegen, die ich ins Zollgebäude zur Kontrolle getragen habe. An der Grenze zur mexikanischen Halbinsel Yucatan liegt eine Freihandelszone mit Bergen vorwiegend chinesischer Textilien und anderer Konsumgüter. Die Einkäufe der Einheimischen sind im neuen Reisegepäck verstaut. Ansonsten hat das Land nur Ansätze moderner Einkaufsmöglichkeiten zu bieten.
Die ehemalige britische Kolonie ist eine eigenartige Nation in der amerikanischen Völkerfamilie. In der Hauptstadt Belmopan wohnen gerade mal 15.000 Einwohner, in der größten Stadt, Belize City, verrotten Hotelruinen und halbverlassene britische Militäranlagen in bester Lage am Meer.
Staatsoberhaupt ist die Königin von Belize. Momentan ist das zugleich die englische Queen Elisabeth die Zweite.
In Belize City weht die Fahne Nationalchinas im Meereswind. Nur eine Handvoll Staaten unterhält noch offizielle diplomatische Beziehungen mit Taiwan, was Wirtschaftshilfe aus dem boomenden kommunistischen Festlandschina weitgehend ausschließt.
Das dünn besiedelte Land hat eine fantastische tropische Pflanzenwelt. Riesenschlangen und Krokodile schwimmen in Mangrovensümpfen und Lagunen. Das einzige Jaguar-Reservat Zentralamerikas schützt 300 verbliebene Exemplare der geschmeidigen Raubkatzen. Einsame Strände, romantische Inseln und Mayapaläste im tiefen Dschungel locken – noch – überschaubare Touristengruppen.
In den Küstenorten mit den schönen Ständen warten Unterkünfte vom Hostal bis zum Hotelresort auf Gäste. Hier sind viele Garifunas zu Hause, Nachfahren schwarzer Sklaven, die nach Sklavenaufständen auf den Karibikinseln geflohen sind und sich hier vor etwa zweihundert Jahren angesiedelt haben. Sechs weitere Bevölkerungsgruppen leben in Belize, zum Teil in getrennten Orten. Die größte Gruppe sind Mestizen, deren Vorfahren indigene Völker und weiße Siedler waren. Etwa ein Drittel der Bevölkerung sind dunkelhäutig oder Kreolen, die von den Antillen als Arbeitskräfte aufs Festland kamen, manche freiwillig, viele als Sklaven.
Orange Walk Town heißt nicht so, weil Orangenhaine zum lieblichen Spaziergang einladen. Vielmehr haben die protestantischen Briten die Stadt nach einer provokanten Demonstration benannt, mit der sie den katholischen Iren in Nordirland zeigten, wer das Sagen auf der grünen Insel hat. In Belize ist Orange Walk die Stadt der hellhäutigen Pflanzer. Auch einige Tausend deutschstämmige Mennoniten haben sich hier im Norden von Belize angesiedelt. In den Dörfern und Wäldern des Berglandes leben die Nachfragen der Mayas. Die Urenkel chinesischer und indischer Arbeiter betreiben oft kleine Läden und Restaurants. Auch arabische Einwanderer sind vor allem im Geschäftsleben aktiv.
Das bunte Gemisch der sieben Bevölkerungsgruppen lebt zu großen Teilen in Armut und in heruntergekommenen Häusern. Recht traditionell sind auch einige Berufsbilder. Die Engländer haben das Land an der Karibikküste als Kolonie „Britisch-Honduras“ gegründet. Nachdem der Konflikt mit Spanien 1670 beigelegt wurde hatten die Briten plötzlich keine Verwendung mehr für die Piraten, deren Angriffe auf die spanischen Gold- und Silberflotten zwischen Kolumbien und Florida sie jahrhundertelang unterstützt hatten. In Old England wollte man die Freibeuter allerdings auch nicht haben. Der moskitoverseuchte Küstenstreifen am Golf von Honduras, der von der Landseite kaum zugänglich war und dessen Mangrovensümpfe und Flussmündungen den Piraten sowieso seit der Entdeckung Amerikas als Zufluchtsort dienten, wurde nun zu ihrer offiziellen Heimat.
Die Macheten-Männer
„Bay People“ heißen die Gründerväter des Kleinstaates heute, was etwas friedfertiger als die Berufsbezeichnung „Seeräuber“ klingt. So ganz vergessen haben die Einheimischen ihre Tradition allerdings nicht, wie die Fahrt von Belize City an den schönen Strand von Hopkins Beach zeigt.
Ich habe die Teerstraße verlassen und über den „Coastal Highway“ eine Abkürzung durch die kaum besiedelte Küstenregion genommen. Die Bezeichnung „Highway“ ist eine heillose Übertreibung. 70 Kilometer geht es auf der harten Wellblechpiste Richtung Hopkins Beach, über Holzbrücken und verwunschene Urwaldflüsse. Der Weg über die Teerstraße und die Hauptstadt Belmopan ist 40 Kilometer länger. Große Verkehrsschilder weisen am Abzweig auf den Coastal Highway hin.
Für meine 650er Suzuki V-Strom ist die Strecke kein Problem. Ich habe mich aber schon gewundert, daß die Pickups und Busse alle die längere Teerstraße von Belize City an die Küste gewählt haben. Denn der „Highway“ ist bei trockenem Wetter ganz gut befahrbar. So bin ich also allein auf der Route, deren Rand dicht bewachsen ist. Nicht einmal Farmen scheint es hier zu geben. Am Horizont zieht ein Gewitter auf.
Ein ausgebranntes Wrack liegt am Straßenrand. Ein Kleinbus, aber das Fabrikat ist nicht mehr erkennbar. Mit Tempo 50 rolle ich über die Staubstraße, weiche einigen größeren Steinen aus. Der beiläufige Blick aufs Buswrack ist eher Abwechslung als Neugierde. Autowracks sind südlich des Rio Grande nichts besonderes. Viele davon fahren sogar noch vollbeladen mit 30 Stundenkilometern über die Panamericana...
Aus dem Augenwinkel erkenne ich eine kleine, kaum wahrnehmbare Bewegung hinter dem Wrack. Die Nackenhaare sträuben sich. Irgendwas stimmt nicht in dieser morbiden karibischen Bilderbuchidylle.
50 Meter vor dem Wrack halte ich mitten auf der Straße an. Alles scheint friedlich. Keine Leine über der Straße gespannt, kein Auto zu sehen. Doch dann bewegt sich am anderen Ende der Busruine etwas. Es müssen also mindestens zwei Leute sein.
Drehen und Gas geben, um zurück zur Teerstraße zu kommen? Sollten sie Schusswaffen haben, wäre das keine überzeugende Idee. Ein intaktes Auto steht nirgendwo. Wenn sie mit den üblichen 125ern aus chinesischer Produktion hierher gefahren sind, werden sie wohl kaum mit der Suzuki mithalten können.
Nach einigen Sekunden fahre ich mit Tempo 30 weiter. Ich habe keinen Bock auf einen Umweg und vielleicht ist der Überfallgedanke ja wirklich übertrieben. Jedenfalls wissen die Zwei (?), dass ich etwas gesehen habe. Als ich heranrolle, tritt ein Mann neben den verrosteten Bus. Abgerissene, dreckige Klamotten, er winkt mit seiner linken Hand. Den rechten Arm hält er halb hinter seinem Rücken. Ich fahre im Stehen weiter und sehe die Machete. Sie reicht bis zu seinen Sandalen…
Langsam rolle ich im zweiten Gang, lasse die Kupplung etwas schleifen und bleibe in der Straßenmitte. Der zweite Mann zeigt sich nicht. Der Macheten-Mann guckt erwartungsvoll und nicht unfreundlich. Zehn Meter trennen uns etwa, als ich die Kupplung kommen lasse und mit meiner linken Hand zurück winke. In der rechten Hand habe ich keine Machete, aber den Griff für 71 PS und 62 Newtonmeter Drehmoment.
Ich finde im Vorbeifahren nicht heraus, was für ein Fabrikat das Buswrack in besseren Zeiten einmal war. Und fragen will ich nicht wirklich. Am Hinterrad steigt Staub auf, dann bin ich am Wrack vorbei. Im Rückspiegel sehe ich, wie der zweite Mann ein paar schnelle Schritte auf die Piste macht. Eine alte Decke oder Plane zerrt er mit der linken Hand hinter sich her, in der rechten Hand hat auch er eine Machete.
Die Suzuki rollt mit Tempo 100 über die Piste. Zeit zum Winken habe ich nicht mehr, aber bei meiner Geschwindigkeit brauchen sich die Beiden keine Gedanken zu machen, ob eine Verfolgungsjagd mit Leichtkrafträdern Sinn macht.