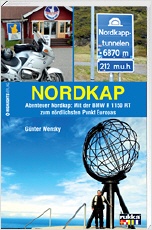7 Kontinente - Leseprobe

Nordamerika, Kapitel 3: In den Rocky Mountains
Auf uns wartet am nächsten Morgen ein weiterer Mythos des Nordens: der Alaska Highway. 1942 hatten die Amerikaner die Hosen gestrichen voll, denn die Angst vor einer japanischen Invasion in Alaska ging um. Der Schock von Pearl Harbour saß noch immer tief. Also beschloss die Armee, eine Straße hinauf nach Alaska zu bauen. Allerdings hielt der unbewohnte Norden eine Reihe heimtückischer Hindernisse parat: riesige Sümpfe, unüberwindbare Gebirge und Milliarden von nervigen Moskitos. Und trotzdem schafften die Amis das kaum für möglich Gehaltene. In nur acht Monaten schoben über 10.000 Arbeiter und Soldaten die neue Straße 2.400 Kilometer durch die bis dahin unberührte Wildnis. Heute beginnt der Alaska Highway offiziell in Dawson Creek im kanadischen Britisch Columbia und endet hoch oben in Alaska in Delta Junction.
Von der originalen Schotterpiste ist allerdings nichts mehr übrig. Obwohl noch immer Tausende in ihren Womos aufbrechen, den Mythos zu suchen und ihre Stoßstangen mit dem berühmten Aufkleber »I drove the Alaska Highway - and survived« verzieren, ist aus der einst kurvigen Piste eine breite und oft schnurgerade Schnellstraße geworden. Kein Wunder, dass wir enttäuscht sind. Mit konstant 90 km/h rollen die Enduros über den langweiligen Asphalt. Die Szenerie ist eintönig, aber trotzdem faszinierend einsam. Dürre Nadelbäume stehen eng beisammen, dazwischen ruhige Flüsse und schwarze Moortümpel. Über Dutzende von Kilometern ändert sich rein gar nichts.
Nur langsam wird die Landschaft wieder spannender. Das liegt vor allem an den grauen Bergen, von denen einige an der 2.000-Meter-Marke kratzen. Nicht eine Wolke trübt den weiten Himmel, und mit 28 Grad ist es erstaunlich warm. Trotzdem haken wir diesen Tag mit 320 Kilometern als reinen Fahrtag ab, als wir abends den Zeltplatz Johnson’s Crossing erreichen. Wir haben nicht das Gefühl, vorangekommen zu sein, weil sich die Szenerie kaum verändert hat. Außerdem bot die einzige Ortschaft des Tages, Teslin, auch nicht viel Abwechslung. Aber solche Tage gibt es öfter im hohen Norden. Die Entfernungen werden immer größer, die Orte seltener. Sind wir nicht genau deswegen hier?
Jein, denn geradeaus auf Asphalt können wir auch zu Hause fahren. Dort aber gibt es weit und breit nichts wie die Canol Road. Und die biegt in Johnson’s Crossing vom Alaska Highway ab.
Die Canol Road ist eine fast 500 Kilometer lange Sackgasse, ein schmaler Weg, der sich durch die Einsamkeit des kanadischen Yukon Territory windet. Vier Tage Natur pur, zwei Schwarzbären, ein Grizzly, fünfzig Karibus, zwei Elche, drei Autos. Die Canol Road präsentiert sich noch fast im Originalzustand, eine schmale buckelige Piste, die sich der Landschaft anpasst, jeden Hügel umrundet und Hindernissen einfach ausweicht. Genau so muss auch der Alaska Highway früher ausgesehen haben.
Dummerweise zieht sich der Himmel mittags zu, und dann setzt auch noch Regen ein. Der macht aus der Piste eine prima Rutschbahn. Enduro-Revier - endlich. Wobei die voll beladene Honda Dominator sich eher wie ein Reisedampfer als eine leichtfüßige Enduro verhält. Birgit geht es mit ihrer Suzuki DR 650 auch nicht besser. Vorsichtig tasten wir uns voran, die Stollenreifen baggern immer öfter durch lustige Schlammlöcher. Als wir abends das Zelt am glasklaren Nisutlin River aufschlagen, haben Ross und Reiter die Einheitsfarbe der Piste angenommen - schlammbraun. Bald faucht der Benzinkocher durch die Stille, Lachsfilets brutzeln in der Pfanne, und die Flasche chilenischen Rotweins - extra in Watson Lake gekauft - wird geköpft. Grenzenlose Einsamkeit und wir mittendrin.
Über Nacht hat sich der Regen verzogen, die Piste trocknet langsam ab. Wie eine Achterbahn kurvt der schmale Weg durch die Berge, hinab in Flusstäler und um moskitoverseuchte Tümpel herum. Zweiter und dritter Gang, mehr geht nicht, ist aber auch nicht nötig. Im winzigen und trostlosen Nest Ross River tanken wir noch mal randvoll, es muss für 500 Kilometer reichen. Eine Fähre bringt uns über den breiten Pelly River. Danach beginnt die North Canol Road. Die hat es in sich, stellt den südlichen Teil der Straße in den Schatten. Die Berge werden höher, der Verkehr tendiert gegen null. Am Straßenrand, oft schon dicht überwuchert, entdecken wir uralte Autowracks. Von 1942 bis 1944 schoben die Amis nicht nur den Alaska Highway, sondern auch die Canol Road durch 830 Kilometer unberührte Wildnis bis Norman Wells am MacKenzie River. Von dort wollte man über eine Pipeline Öl in den Westen befördern, um die US-Armee zu versorgen. Sämtliches Gerät ließen die Amerikaner zurück. Und so rosten noch heute an die 100 Jeeps und Laster entlang der Straße vor sich hin. Erstaunlich, wie gut die Oldtimer nach 58 Jahren noch aussehen.
Die Landschaft wird spektakulärer, je weiter wir vorankommen. Wie eine Wand türmt sich vor uns die Itsi Range auf, gewaltige, vergletscherte Berge. Unten im Tal schäumt der South MacMillan River ungestüm und wild. Auf einer schmalen Holzbrücke überqueren wir den Fluss. Die Piste gewinnt an Höhe, unglaubliche Schlaglochserien strapazieren die Stoßdämpfer und die braunrotgrünen Berge die Sehnerven. Kanada wie aus dem Bilderbuch. Wenig später parken rechts der Piste ordentlich aufgereiht 40 Autos. Zumindest wurden sie vor 58 Jahren in Reih und Glied hinterlassen. Seitdem rosten sie vor sich hin, sind zum größten Teil ausgeschlachtet worden und geben ein bizarres Bild ab inmitten der ansonsten unberührten Natur. Das erste und einzige Auto des Tages kommt vorbei. Ein Texaner mit einem mächtigen Dodge-Pick-up. Natürlich hält er an. Tony erzählt von seiner alten BMW R 90, mit der er aber niemals bis hierher gefahren wäre: »Zu hart für das alte Schätzchen.«
Auch Tony will genau wie wir bis zum MacMillan Pass, dem Ende der Canol Road, und dann wieder zurück. Mit einem »see you later« fährt er schon mal vor, während wir uns noch einen Kaffee kochen. Einpacken, weiterfahren. Die Vegetation wird immer dürftiger, macht grünen, grauen und braunen Hängen Platz. Wir fühlen uns an Island erinnert. Auch die Temperatur passt dazu, erreicht kaum noch zehn Grad. Ich denke an Tony, der uns bald wieder begegnen müsste. Vorsichtshalber fahre ich auf der unübersichtlichen Piste jetzt ganz rechts und drossele das Tempo. Und da kommt der Texaner auch schon - dummerweise in einer Rechtskurve auf meiner Seite. Er scheint zu pennen oder die Berggipfel zu bewundern. Jedenfalls reagiert er überhaupt nicht, hält direkt auf mich zu. Ich bremse hart, zu hart auf dem geschotterten Untergrund. Beide Räder blockieren, was in Schräglage weniger gut ist. Also wird die Schräglage noch schräger und endet in der Rutschlage. Ich sehe mich schon mit dem fetten Pick-up kollidieren, als Tony mich erkennt, das Lenkrad herumreißt und bremst. Zu spät. Die Dominator rutscht ins Vorderrad des Dodge, ich komme in der einzigen Schlammpfütze zwischen Eismeer und Kalifornien zum Stillstand und sehe nur noch braun. Na klasse. Ich sehe aus wie die Sau.
Und die Honda? Eine Alukiste ist abgerissen, der Lenker arg verbogen, und der Tankrucksack hat seinen Inhalt durch einen langen Riss auf die Piste verteilt. Erstaunlich, dass die Plastikverkleidung der Dominator bis auf ein paar tiefe Kerben heil geblieben ist. Ich rappele mich auf, unterdrücke das »nice to see you again«, wuchte die Honda auf die Räder und begutachte den Schaden. Tony sagt überhaupt nichts, was wohl auch besser ist. Wenigstens hat er schweres Werkzeug an Bord, und mit Axt und Hammer richten wir die Alukiste so weit, dass sie wieder an den Gepäckträger passt. Auch der Lenker muss sich der Gewalt beugen, nimmt zumindest wieder annähernd gewohnte Formen an. Wir tauschen unsere Adressen aus, Tony zeigt mir Führerschein und Versicherung für seinen Dodge, gibt kleinlaut zu, dass er wohl gepennt habe und macht sich auf den Weg nach Süden. Ich suche mir den nächsten Bach und befreie mich vom Schlamm der Pfütze.
Die Dominator läuft mit dem schiefen Lenker etwas ungewohnt, aber es hätte auch schlimmer kommen können. Kaum zwei Kilometer weiter stehen wir am MacMillan Pass und damit an der Grenze zu den Northwest Territories. Ab hier verfällt die Piste seit Jahrzehnten. Wie zum Beweis verschwindet die Spur in einem Fluss, die alte Holzbrücke ist eingestürzt. Wir schlagen an Ort und Stelle das Zelt auf, haben einfach keine Lust mehr zum Fahren. Als wäre die Begegnung mit dem Dodge nicht genug für heute, bekommen wir abends weiteren Besuch. Zu Hunderten fallen Moskitos über uns her. Bei jedem Bissen des Abendbrots schlucken wir etwas Protein in Form dicker, fetter Mücken mit runter. Fressen und gefressen werden. Ein Feuer würde jetzt helfen, aber hier oben auf 1.400 Meter gibt es keine Bäume mehr. Also muss die chemische Keule raus. Das in Deutschland gekaufte Mittel ist den Moskitos hier gänzlich unbekannt. Warum also sollten sie darauf reagieren? Erst als wir die für den Alaska-Einsatz empfohlenen stärkeren Kampfstoffe einsetzen, haben wir etwas Ruhe vor den Plagegeistern.
Moskitos im hohen Norden sind übrigens weit weniger schlimm, als es gerne erzählt wird. Natürlich gibt es Orte, wo uns diese Viecher schlichtweg in den Wahnsinn treiben. An den meisten Tagen werden wir fast gänzlich verschont. Aber es gibt nicht nur Moskitos, das wäre viel zu einfach. Kleine schwarze Fliegen, die Black Flies, können den ruhigen Abend zur Hölle machen. Black Flies stechen nicht, sie beißen kleine Stückchen aus der Haut, hinterlassen einen blutigen Fleck. Und dann gibt es noch die gemeinsten aller Plagegeister. Alaskaner nennen sie »No-See-Ums«, in Skandinavien hören sie auf den Namen »Knotts«, und der Schotte kennt sie als »Midges«. Wir nehmen den alaskanischen Namen »No-See-Ums« als Basis, kürzen ihn aber zu »NSU« ab. Diese »NSUs« sind winzig klein, stechen, kriechen in alle Körperöffnungen wie Nasen und Ohren und haben nicht den geringsten Respekt vor Anti-Moskito-Mittelchen. Im Norden werden alle diese netten Tierchen unter dem Begriff »Bugs« zusammengefasst. Und gegen Bugs hilft nur eins: Bug-dope.
Genau das benötigen wir auch am nächsten Morgen, als mich lautes Gesirre weckt. Zwischen Innen- und Außenzelt wartet die stachelige Armada auf unsere nackte Haut. Wir versuchen, die Meute zu zählen, kommen auf etwa 200 bekannte Flugobjekte. Da hilft nur ein Überraschungsangriff. Anziehen und blitzartig raus aus dem Zelt. Das Frühstück wird verschoben. Und trotzdem zieht sich unser Aufbruch noch etwas hin. Schließlich will ich die Blutsauger aus dem Zelt locken, bevor ich es einrolle. Denn diese fetten Flieger würden sonst ebensolche Flecken im Zelt hinterlassen. Dann aber geben wir Gas und erreichen mit dem letzten Tropfen Benzin Ross River.
Es ist nicht mehr weit bis Whitehorse, der Hauptstadt des Yukon Territory. Es tut gut, mal wieder in einer Stadt zu sein. Wird aber auch Zeit, die Motorräder durchzusehen und das Öl zu wechseln. Endlich treffen wir auf dem Zeltplatz andere Biker. Wie Günter aus Bremen, der schon seit zehn Tagen auf ein Ersatzgetriebe für seine BMW wartet. Oder der Holländer Hans, seit zwei Jahren auf Weltreise. Oder das japanische Pärchen mit perfekt umgebauten Honda XL 250, das nach vier Jahren »on the road« gerade auf dem Weg nach Hause ist. Die Abende werden lang am Ufer des Yukon River, das Lagerfeuer vertreibt die Moskitos, und Geschichten aus aller Welt machen die Runde.