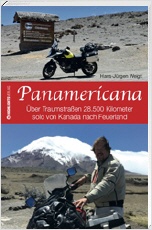Atempause - Leseprobe
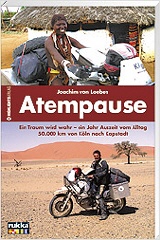
Kapitel 8: Kenia – Lebensretter in der Wüste
Die Fahrt nach Omorate, das schon an der Grenze nach Kenia liegt, läuft reibungslos. Als ich die Einreiseformalitäten quasi schon erledigt habe, fällt dem äthiopischen Grenzer auf, dass mein Visum für Äthiopien bereits seit 35 Tagen abgelaufen ist. Genau genommen müsste ich jetzt zurück nach Addis, um ein neues Visum zu beantragen. Natürlich möchte ich auf keinen Fall einen Umweg von 1.600 Kilometern in Kauf nehmen.
Nach viel Rederei und erstaunlicherweise ohne Geldzuwendungen verständigen wir uns darauf, dass er meinen Pass zweimal abstempelt. Also so, als wäre ich zuerst fristgerecht ausgereist und dann noch einmal. So hat dann endlich alles seine Richtigkeit.
Von der Fahrt nach Illert, das bereits in Kenia liegt, wird mir abgeraten. Die Strecke sei einfach zu sandig. Das stimmt. Volker und Manuela, deutsche Bekannte aus Addis, die auf zwei Hondas unterwegs sind, haben es versucht und entnervt abgebrochen. Sie ließen sich schließlich mit dem Boot über den Omo bringen.
Auch mir wird empfohlen, mit dem örtlichen Polizeiboot auf die andere Seite des Omo überzusetzen. Ab dort sei die Strecke unproblematisch zu befahren. Am Nachmittag erfahre ich jedoch, dass der Polizeihauptmann erst in zwei Tagen zurückkommt. Vorher läuft nichts.
Da ich aber nicht so lange warten möchte, besorge ich mir am nächsten Morgen einen einheimischen Führer. Er soll mir helfen, die versandeten Stellen zu umgehen und mich über Ziegenpfade durch den Busch über die Grenze nach Illert bringen. Mutig setzt er sich hinter mir auf die voll bepackte Maschine, und wir starten. Über kleinste Wege mogeln wir uns voran und müssen häufig Einheimische fragen, bis wir tatsächlich auf die Straße nach Illert treffen. Kurz vor Illert verlässt mich mein Führer und verschwindet sofort, nachdem er sein Geld erhalten hat. Offensichtlich hat er Angst, von der kenianischen Polizei aufgegriffen zu werden.
Ich mag etwa einen Kilometer gefahren sein, als plötzlich das Zahnrad auf der Antriebswelle nicht mehr greift. Das Motorrad bleibt schlagartig stehen. Ich bin gezwungen, die schwere Twin durch den Sand zu schieben. Dabei treffe ich eine Frau mit Kind auf dem Arm. Sie hilft mir schieben. Ein Bild für die Götter! Nach Fotografieren ist mir allerdings nicht zumute.
Nach einiger Zeit verlassen uns die Kräfte und ich muss die Maschine zurücklassen. Durstig und ermüdet erreiche ich Illert, nachdem ich einen letzten Abhang hochgestiegen bin. Oben angekommen treffe ich ein paar Einheimische, die Englisch sprechen.
Sie bringen mich zu Pater Florian. Der Missionar lebt seit 25 Jahren in Afrika und ist ein Spross alten bayerischen Landadels. Unter seinem Filzhut quillt braunes lockiges Haar hervor. Er lässt meine Maschine von einem Trecker abholen.
Zu meiner großen Überraschung sind eine Plastiktüte, die ich als Abdeckplane benutze, und das Packband, das ich zur Fixierung des Gepäcks brauche, verschwunden. Offensichtlich sind diese Gegenstände, die einen materiellen Wert von wenigen Cent besitzen, entwendet worden. Meine Digitalkamera und den Weltempfänger hat jedoch niemand angerührt. Hatte man hierfür keine Verwendung, oder wusste man nichts mit diesen Gegenständen anzufangen? Oh, wundersames Afrika. Hier komme ich wirklich aus dem Staunen nicht heraus.
Am nächsten Tag schlafe ich bis zum Nachmittag, so erschöpft bin ich vom Vortag. Dann wird der Antrieb vom Motorrad geschweißt. Danach bietet ein abendliches Bad im Turkanasee Entspannung. Das Binnengewässer, das 318 Kilometer lang und 56 Kilometer breit ist, zählt zu den größten alkalischen Seen unseres Planeten. 1887 wurde er von dem ungarischen Grafen Samuel Teieki von Szek und dem Leutnant Ludwig von Höhnel entdeckt. Zu Ehren des österreichisch-ungarischen Kronprinzen Rudolf von Habsburg, der große Begeisterung für diese Expedition hegte, nannten sie ihre Entdeckung »Rudolf-See«. Die ansässige Bevölkerung bezeichnete ihn damals als »Basso Narok«, den »Schwarzen See«. Aufgrund seines türkisfarbenen Wassers trägt er auch die Bezeichnung »Jademeer«.
Der Turkanasee ist fast ständig von starken Winden umpeitscht und von wüstenartiger Landschaft umgeben. In dem fisch- und vogelreichen Biotop leben auch Krokodile. Die Anwesenheit des großen Nilbarsches, der bis zu 90 Kilogramm schwer werden kann, legt die Vermutung nahe, dass der See in früheren Zeiten mit dem Nil verbunden war.
Gespeist wird er von den Flüssen Omo und Turkwel. Da diese zu Energiegewinnungs- und Bewässerungszwecken oberhalb des Sees gestaut werden, ist der Wasserspiegel des Turkana in den vergangenen Jahren stark abgesunken. Hinzu kommt, dass die Niederschläge im Nordwesten Kenias in den letzten Jahren sehr schwach und unregelmäßig waren. Eine große Dürre herrschte. Dementsprechend verlandete die seichte Bucht des Ferguson-Golfs, der einst ein großes Laichgebiet der Fische war, schon vor etlichen Jahren völlig. Es gibt also auch in Kenia große Umweltprobleme.
Ich beschließe, noch einen Tag die Gastfreundschaft von Pater Florian in Anspruch zu nehmen. Diese Zeit nutze ich, um die Ausgrabungsstätte von Kobi Fora zu besuchen. Hier an den Ufern des Turkanasees wurde 1972 ein fast vollständiger Schädel des Homo Habilis gefunden, der etwa 1,8 Millionen Jahre alt ist. Der Homo Habilis stellt die erste menschliche Art dar, welche die Erde bevölkerte.
Nach diesem Ausflug in die früheste Menschheitsgeschichte beobachte ich die ärztliche Behandlung von Kindern in einem Fora. Dies ist die nur aus Zweigen und Blättern bestehende Unterkunft der nordkenianischen Dazenetsch, einem Hirtenvolk. Die Dazenetsch sind mit ihren Rinderherden, die ihren ganzen Reichtum und Stolz darstellen, fast ständig auf der Wanderung zu irgendwelchen fruchtbaren Weidegründen. Machen sie irgendwo Halt, dann wird rasch ein Fora erbaut. Wie mir Pater Florian erzählt, erschwert dies ungemein die von Missionaren durchgeführte medizinische Versorgung, da man nie genau weiß, wo sich ein Patient vielleicht morgen schon aufhalten wird.
Das ist der Grund, weshalb man so viele Menschen mit amputierten Fingern oder Zehen sieht. Oftmals entwickeln sich in den verletzten Gliedern, die nur mangelhaft und unhygienisch versorgt werden können, Entzündungen. Nur durch die Amputation des betroffenen Körperteils lässt sich in diesen Fällen das Leben des Patienten retten.
Für ihre Gastfreundschaft spendiere ich den Missionaren eine Ziege. Die wird von uns gemeinsam geschlachtet, gegrillt und verzehrt. Als wir gerade genüsslich mit unserem Mahl begonnen haben, kommt ein kleiner Junge zur Tür hereingestürmt. Er fragt höflich nach dem Küchenmesser, das wir gerade noch zum Zerteilen der Ziege benutzt haben. Er braucht es dringend, denn seine Mutter entbindet zur Stunde. Pater Florian leiht ihm das Messer bereitwillig. Ich frage ihn, wie die Schwarzen sonst im Busch ohne Messer entbinden. »Sie schneiden die Nabelschnur mit einer Scherbe durch oder zerbeißen sie einfach mit den Zähnen«, antwortet er.
Dann nehme ich Abschied von Pater Florian. Die Fahrt durch den Norden Kenias ist sehr einsam. Ich habe Angst, dass ich von der richtigen Wegstrecke abkomme. Es begegnet mir kein Mensch, den ich fragen könnte. Ich bin mutterseelenallein.
Jetzt wird mir bewusst, wie hart und gefährlich es ist, wenn man alleine mit dem Motorrad durch eine unbesiedelte Region fährt. Hier kommt höchstens ein Fahrzeug pro Woche vorbei. Jedes Festfahren und jeder Sturz kann daher zur tödlichen Gefahr werden. Denn kein Mensch ist da, der einem beistehen könnte. Man kann auch keine Hilfe rufen. Es wäre mehr als ein glücklicher Zufall, würde man jemanden treffen.
Entsprechend erleichtert bin ich, als ich kurz vor Anbruch der Dunkelheit die Polizeistation in Derate erreiche. Die Beamten sind sehr hilfsbereit und geben mir Unterkunft, Wasser und Verpflegung.
Mit Hilfe eines der Polizisten muss ich am nächsten Morgen zuerst einmal das Hinterrad flicken. Offensichtlich habe ich mir gestern kurz vor Derate ein Loch in den Reifen gerissen und es nicht bemerkt. Über Nacht ist dann langsam die ganze Luft entwichen. Zügig ziehe ich mit den beiden Montierhebeln den Reifen von der Felge und repariere das Loch im Schlauch. Ein paar Mal hält das ein Schlauch aus, dann ist er hinüber, und ich muss einen neuen kaufen.
Vor der Abfahrt bitte ich die Polizisten, die deutsche Missionsstation in North Horr anzufunken. North Horr ist 110 Kilometer entfernt und mein nächstes Etappenziel. Würde ich um 16.00 Uhr noch nicht in North Horr sein, sollte man dort bitte einen Suchtrupp losschicken.
Ich bedanke mich herzlich bei meinen Helfern und verlasse den Ort guten Mutes.
Heute geht es über sehr steiniges Gelände, typisch für die nordkenianische Wüste. Kein Wunder, dass ich nach nur zehn Kilometern schon wieder einen Platten habe. Aber das ist erst der Anfang meines heutigen Pechs. Kurz darauf geht meine Vorderradbremse nicht mehr. Dann folgen zwei weitere Platten am Hinterrad. Es ist zum Verrücktwerden. Gut, das niemand hören kann, wie ich laut vor mich hinfluche.
Als ich mich etwas beruhigt habe, sehe ich mir die Honda ganz genau an. Ich befürchte, dass durch das kaputte Felgenband des Hinterrades die Speichenenden immer wieder auf den Radschlauch drücken, der dadurch Luft abgibt.
Entnervt gebe ich auf. Noch 1,5 Liter Wasser habe ich bei mir. Das wird knapp. Meine einzige Chance ist der Rückmarsch zu Fuß zur Polizeistation nach Derate. Ich rechne aus, dass ich diese nach 15 Stunden Fußmarsch erreichen muss, wenn ich unterwegs nicht verdursten will. Alle 15 Minuten darf ich mir einen Schluck Wasser genehmigen. Auf diese Weise müsste ich die Strecke, sollte nichts Dramatisches passieren, eigentlich schaffen.
Ich schreibe einen kleinen Zettel in Deutsch, auf dem steht: »Bin zurückgelaufen zur Polizeistation nach Derate.« Dann mache ich kehrt und begebe mich auf den mühevollen Rückzug. Der ist heiß und anstrengend. Mein Körper verliert viel Flüssigkeit. Da ich den Wasserverlust nur sehr mangelhaft ausgleichen kann, stellen sich bald schon bohrende Kopfschmerzen ein. Hoffentlich halte ich durch.
Tief in Gedanken versunken, marschiere ich in Richtung Polizeistation, als plötzlich hinter mir eine Ambulanz mit Blaulicht auftaucht. Die kann sicherlich nicht für mich sein, die wollen nur einen kranken Kenianer abholen.
Doch der Wagen kommt neben mir zum Stehen. Der einheimische Fahrer ruft, ob ich Joe, der Deutsche, sei. Woher kennt er meinen Namen? Es sind tatsächlich die Retter aus der Missionsstation North Horr. Sie hatten zur Zeit keinen anderen Wagen frei, daher kamen sie mit der Ambulanz.
Der Fahrer gesteht mir, dass er mit dem Zettel nichts anfangen konnte, weil Deutsch nicht seine Muttersprache sei. Aber die Spuren, die ich hinterließ, konnte er lesen. Da das Motorrad nicht in den Laderaum der Ambulanz passt, müssen wir es zerlegen. Zwei Stunden später sind wir soweit, und die Türen des Autos lassen sich schließen. Danach geht es drei Stunden lang über steinige Pisten in den rettenden Hafen. Dort warten Hubert und Toni, zwei Missionare aus Bayern. Ich bin überglücklich. Gemeinsam genießen wir das Abendessen. Es gibt etwas ganz Besonderes, nämlich frische Tomaten und bayerisches Bier.
Dieser Tag war der extremste, den ich bisher in Afrika erlebt habe. So etwas möchte ich nicht noch einmal durchmachen. Die Anstrengungen haben mich nicht nur in den Grenzbereich meiner Leistungsfähigkeit gebracht, das Ganze hätte sogar töd?lich enden können.