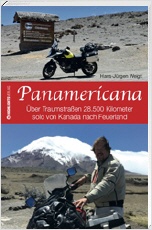Auszeit - Leseprobe
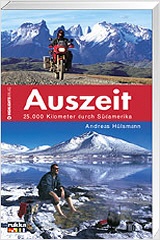
Kapitel 6: Feuerland - das Ende der Welt
Die Sonne ist längst hinter den Bergen verschwunden, als wir uns in Richtung Torres del Paine aufmachen. Von Chile aus gibt es keinen direkten Weg in diese Region. Das Inlandeis macht eine Straßenverbindung in Richtung Süden unmöglich. Die einzige Piste endet irgendwann im Meer. Der Weg in den Nationalpark führt deshalb entweder über Argentinien oder über das Wasser.
Wir kommen nur langsam voran, was diesmal jedoch nicht am Wind oder an den schlechten Pisten liegt, sondern an der grandiosen Kulisse, auf die wir zusteuern. Wie eine uneinnehmbare Festung erheben sich die bis zu 3.000 Meter hohen Granitzinnen aus der patagonischen Ebene. Es weht ein eisiger Wind von diesen Bergen herab. Das Motorradfahren wird ziemlich ungemütlich, als sich die Sonne für diesen Tag zurückzieht. Wir bauen die Zelte an einem See mit direktem Blick auf die bizarren Felsformationen auf.
Unsere Wasservorräte sind erschöpft. Dummerweise können wir sie nicht auffüllen, da das Wasser aus dem hellblau schimmernden See nicht genießbar ist. Einige Kilometer von hier entfernt haben wir jedoch eine Straßenbaukolonne passiert - vielleicht können wir ja dort einige Liter Wasser bekommen. Birgit und ich fahren zurück. Eine Handvoll Arbeiter lebt in Containern direkt neben der Straße. Sie begrüßen uns freundlich. Der Koch, der wichtigste Mann im Camp, wie er uns selbst versichert, hat gerade Tee gemacht, zu dem er uns prompt einlädt.
Viele der Männer, die hier am südlichsten Zipfel der Zivilisation arbeiten, haben ihre Familien über mehrere Monate nicht mehr gesehen. Den ganzen Sommer sind sie damit beschäftigt, die Zufahrtsstraßen für den Nationalpark zu verbessern. In ein bis zwei Jahren, so erzählen sie nicht ohne Stolz, wird es eine wunderbar asphaltierte Straße zu den Torres geben, damit die Besucher nicht mehr durch den Staub fahren und sich durchrütteln lassen müssen. Dass uns die glattgewalzten, staubigen Pisten lieber sind als blitzblanke Asphaltstreifen, können sie nicht verstehen. Drei Tassen Tee später verlassen wir die freundlichen Bauarbeiter und fahren zurück zu unseren Zelten, natürlich nicht ohne unsere leeren Wassersäcke aufgefüllt zu haben.
Es ist stockfinster, als wir unseren Lagerplatz erreichen. Wir frieren. Denn nachdem sich die Sonne verabschiedet hat, ist es auf einmal bitterkalt geworden. Der eisige Wind hilft eifrig, um ja keine Gemütlichkeit aufkommen zu lassen. Wir sind hungrig wie die Wölfe, denn wir haben den ganzen Tag kaum etwas gegessen. Ich habe das Gefühl, als wäre mein Magen dabei, sich selbst zu verdauen. Die paar Kekse im Laufe des Tages waren ein nicht gerade üppiges Mahl.
Doch nun besteht Anlass zur Freude. Es gibt Spaghetti. Diese Teigstangen sind zu unserem Hauptnahrungsmittel geworden. Ihre lange Haltbarkeit, die einfache und schnelle Zubereitung und das kleine Packmaß sind Vorzüge, die auf einer Reise mit dem Motorrad elementare Bedeutung erlangen. Dass es die Spaghetti heute auch noch mit »Bog« gibt, macht unser Abendessen zu einem Festmahl. In El Calafate hatten wir nämlich gefrorenes Mett bekommen, das unsere Nudeln jetzt mit einer schönen Bologneser-Soße bereichert. Dazu gibt es - wie meistens - Rotwein. Gato Negro aus der Tetrapack-Tüte. Dieser chilenische Tropfen ist nicht nur sehr lecker und süffig. Es gibt ihn auch in fast jedem Lebensmittelladen zu kaufen. Und sobald wir in unseren Koffern und Packtaschen ein wenig Platz übrig hatten, wurde der mit Gato Negro aufgefüllt.
Das Kochen war am Anfang der Reise oft Anlass zur Diskussion. Jeder von uns hatte so seine Vorlieben und brachte eigene Rezepte mit, die er gerne im Topf verwirklicht sehen wollte. Mittlerweile ist es uns jedoch gelungen, die ganzen individuellen Kreationen zu einem einzigen für alle akzeptablen kulinarischen Hochgenuss zusammenzufassen.
Richtig genießen lässt sich unser Festessen heute aber nicht. Die Spaghetti verwandeln sich bei den eisigen Temperaturen innerhalb weniger Minuten zu einem kalten Teigklops. Wer sie im warmen Zustand verspeisen möchte, muss beim Essen schon ein ordentliches Tempo vorlegen. Genießer kommen in Patagonien wohl selten zu einer warmen Mahlzeit.
Nach dem Essen trauen wir unseren Augen nicht: Obwohl wir uns mitten im Hochsommer befinden, hat sich eine dünne Eisschicht auf unseren Zelten gebildet. In den subantarktischen Gebieten, die nicht mehr weit von uns entfernt sind, scheint der Winter immer präsent zu sein.
Der nächste Morgen beginnt mit einer Sensation: Es ist windstill - oder sagen wir besser: fast windstill. Nur eine leichte Brise streicht über das Land. Patagonien zeigt sich von einer ganz ungewohnten Seite. Kein Staub, der durch die Luft wirbelt und sich in Mund, Augen und Nase festsetzt. Keine Böen, die an allem zerren und jeden Gegenstand mit sich reißen, der nicht am Boden befestigt ist. Und es ist ruhig, fast still. Der patagonische Wind lässt uns für einen Moment verschnaufen.
Es ist ein seltsames Gefühl, so ohne Wind. Seitdem wir von Buenos Aires aus in Richtung Süden fahren, war er irgendwie immer da. Zu Beginn unserer Reise haben wir ihn gehasst, ärgerten uns über die eigene Machtlosigkeit, gegen den unablässig blasenden Wind nichts ausrichten zu können. Doch allmählich gewöhnen wir uns daran. Der Wind ist einfach da und weht mal mehr und mal weniger heftig über das Land.
Doch jetzt, an diesem Morgen, wo sich kaum ein Lüftchen regt, fehlt er mir fast. Patagonien ist eben nicht Patagonien ohne den stürmischen Wind. Beim Abbau des Zeltes ertappe ich mich dabei, wie ich trotz der Flaute alle Gegenstände sorgsam fixiere, damit sie nicht davongeweht werden. Das »Anschnallen«, wie wir es nennen, ist zur Routine geworden.
Es sind nur noch wenige Kilometer bis zum Eingang des Torres del Paine Nationalparks. Diese Berglandschaft am Ende der Welt wird als schönster Nationalpark Südamerikas bezeichnet. Es gibt wohl kaum einen Reisenden, der sich diese grandiosen Granitfelsen und Gletscher entgehen lässt. Das wissen auch die Chilenen. Und so müssen die »extranjeros«, die Ausländer, 16 US-Dollar Eintritt zahlen. Für Einheimische kostet das Ticket nur die Hälfte. Doch auf Chilenen trifft man im Park selten. Denn auch 8 US-Dollar sind für einen chilenischen Arbeiter viel Geld.
Mit dem Eintritt ist die Rechnung jedoch noch nicht ganz bezahlt. Für die Zeltplätze müssen ebenfalls ein paar Scheine locker gemacht werden - und diese Campingplätze gehören zu den teuersten im ganzen Land. Zwar wird Torres del Paine vom Staat verwaltet, doch die erforderliche touristische Infrastruktur ist in der Hand von Privatfirmen. Die Unternehmer wissen um die Attraktivität und die Anziehungskraft, die der Nationalpark auf ausländische Besucher ausübt, und gestalten dementsprechend ihre Preise.
Wir verbringen herrlich ruhige Tage im Torres del Paine. Es kommt während dieser Zeit sehr selten vor, dass wir unsere Motorräder bewegen. Dass wir im Nationalpark sowohl Marion und Ralf als auch Astrid und Daniel wiedertreffen, macht den Aufenthalt umso angenehmer. Jeder von uns erzählt von den kleinen Abenteuern und Anekdoten, die er während der Reise erlebt hat.
Jo, Birgit und ich haben diesen beiden Pärchen inzwischen Spitznamen gegeben. So nennen wir Astrid und Daniel einfach nur die »Pan Ams«, weil sie auf dem Weg hierher von Alaska aus der Panamericana gefolgt sind. Marion und Ralf haben von uns den Namen »agua caliente« erhalten. Aus dem Spanischen übersetzt bedeutet das so viel wie »heißes Wasser«.
Diese Bezeichnung haben sie deshalb von uns bekommen, weil sie - nur um eine heiße Dusche genießen zu können - einen Umweg von fast 120 Kilometern machten. Wir lachten Tränen, als Ralf und Marion uns diese Geschichte beim ersten Zusammentreffen erzählten. Ich habe noch heute die Worte im Ohr, mit denen Ralf diese Geschichte abschloss: »Man muss Prioritäten setzen ...«
Es ist eine wirklich traumhafte Zeit im Torres del Paine. Wir wandern durch die Gegend oder genießen von unserem Zeltplatz aus einfach nur die Aussicht. Von hier können wir quer über den Lago Pehoe zu den Cuernos del Paine - den Hörnern - schauen, den zwei gigantischen Granitblöcken am anderen Ende des Sees, die sich bis zu 2.500 Meter in den Himmel recken.
Allerdings ist unsere Freizeit an diesem schönen Platz zeitlich begrenzt. In wenigen Tagen wird nämlich Anne in Ushuaia landen. Wenn sie in der südlichsten Stadt der Welt ankommt, sollte ich möglichst am Flughafen stehen.
Zwischenzeitlich haben uns auch Marion und Ralf sowie Astrid und Daniel verlassen. Trotzdem fällt es mir so schwer wie noch nie, mein Zelt abzubauen. So wunderschön ist dieser Ort. Mir bleibt nur der Trost, dass wir in spätestens zwei Wochen auf unserem Weg Richtung Norden wieder hier Halt machen werden.
Unser Weg führt uns zurück nach Cerro Castillo und von hier aus Richtung Puerto Natales, einer kleinen, am Canal Seoret gelegenen Hafenstadt. Dieser Kanal gehört zum Mar Interior, dem Binnenmeer, das über ein Gewirr von Seitenarmen mit dem Pazifik verbunden ist. Diese Region, deren Herz Puerto Natales ist, wird Ultima Esperanza, letzte Hoffnung, genannt. Wer durch diese vom Wind gepeinigte Gegend fährt, wird schnell verstehen, warum die Pioniere dem Land diesen Namen gaben. Es war wohl die Hoffnung, in dieser Einöde doch noch irgendetwas zu finden, was von Nutzen sein konnte.
Puerto Natales ist für uns wie wohl für die meisten anderen Reisenden nur Durchgangsstation. Der Ort dient als Ausgangspunkt für Touren in den Torres del Paine. Wer ohne eigenes Fahrzeug in den Nationalpark hinein möchte, muss sich in dieser Stadt um ein geeignetes Transportmittel kümmern.
In Puerto Natales nutze ich eine der zahlreichen Telefonzellen und rufe zu Hause an. Meine Mutter hat Geburtstag, und ich möchte gerne ein paar Worte mit ihr wechseln. Den Geburtstagswünschen folgt ein längeres Gespräch mit Anne. Ich brauche meine ganze Überzeugungskraft. Denn unsere Liste mit Dingen, die wir hier unten schmerzlich vermissen, wird immer länger. Annes Nervosität ist am Telefon deutlich zu spüren. Sie hat hochgradiges Reisefieber, und über die Distanz von rund 18.000 Kilometern gelingt es mir kaum, sie zu beruhigen. Aber eigentlich freuen wir uns beide riesig, uns nach mehr als zwei Monaten Trennung wiederzusehen. Tja, die Auszeit. So gut sie mir auf der einen Seite tut, so schmerzlich ist dabei der menschliche Aspekt.
Vor uns liegen 250 Kilometer bis Punta Arenas. Eine kleine Asphaltstraße führt fast schnurgerade in Richtung Süden. Auch unser ständiger Begleiter hat sich wieder eingefunden: Ein eisiger Wind, diesmal aus der Antarktis kommend, bläst uns geradewegs ins Gesicht. Dann und wann wird er so stürmisch, dass ich vom fünften in den dritten Gang runterschalten muss, damit der Motor nicht abstirbt.
Das Teerband, auf dem wir fahren, ist so schmal, dass ein Auto gerade noch Platz darauf hat. Bei Gegenverkehr müssen wir in den Schotter ausweichen, denn hier unten gilt gnadenlos das Recht des Stärkeren. Und die meisten Fahrer, die uns entgegenkommen, machen davon Gebrauch. Auch das Überholen der langsamen Lkws ist kein Zuckerschlecken. Jedes Mal müssen wir dabei raus in den Schotter, was bei diesen Windverhältnissen mächtig Unruhe ins Fahrwerk bringt.
Die Fahrt kostet viel Kraft. Man kann sagen, dass dieser Abschnitt einer der härtesten der bisherigen Tour ist. Doch nun haben wir Punta Arenas erreicht. Stolz nennt sie sich »südlichs?te Kontinentalstadt der Welt«. Ein Superlativ findet sich immer, wenn man nur lange genug sucht.
Doch wir haben ein ganz anderes Problem. Den Zeltplatz, den es laut Reiseführer in Punta Arenas geben soll und dessen Existenz die junge Dame in der Touristeninformation beschwört, können wir nicht finden. So intensiv wir auch den Stadtrand nach Hinweisen auf einen Campingplatz absuchen - diese Einrichtung bleibt uns verborgen.
Für die Sehenswürdigkeiten Punta Arenas’ haben wir an diesem Spätnachmittag naturgemäß keine Augen. Mir fällt nur auf, dass die Stadt aufgeräumter und ordentlicher wirkt als andere Städte Patagoniens. Obwohl die goldenen Jahre dieses Ortes an der Magellanstraße längst vorbei sind.
Das so genannte Gold dieser Region war einst weiß und fraß Gras: Schafe waren der Garant für Wohlstand und Reichtum. Einige Estancien erreichten gigantische Ausmaße - bis zu 90.000 Hektar Land gehörten damals zu einer Farm. Aber diese Zeiten sind längst vorbei, denn der Wollpreis auf dem Weltmarkt ist im Keller. Die erwirtschafteten Gewinne der Schafzüchter liegen heute nicht selten nur knapp über dem Existenzminimum.
Wir suchen immer noch nach dem Zeltplatz. Mittlerweile sind wir schon zum dritten Mal in der Touristeninformation, und immer wieder hat die nette junge Dame eine neue Idee, wo sich das Campingareal befinden könnte. An ihrem Willen, uns behilflich zu sein, gibt es wirklich keinen Zweifel. Irgendwann finden wir dann tatsächlich diesen Campingplatz. Der ist aber geschlossen. Und so wie es aussieht, wohl schon seit längerem.
In der Touristeninformation gibt man sich überrascht, als wir dort unsere Entdeckung bekannt geben. Doch dann rückt man mit einer Alternative heraus. Es gebe da nämlich noch einen kleinen Nationalpark weiter draußen außerhalb der Stadt. Allerdings dürfe man dort vermutlich nicht zelten. Für uns wäre es jedoch die einzige Möglichkeit, wenn wir unbedingt campen wollten.
Mit diesen wagen Angaben und einer dürftigen Wegbeschreibung im Kopf machen wir uns auf den Weg. Es wird langsam Zeit, eine Bleibe für die Nacht zu finden. Mir wäre jetzt auch eine Pension, eine Hospedaje, recht. Birgit denkt ähnlich. Nur Jo, der Hotel-Gegner, bleibt hart. Wir einigen uns auf einen Kompromiss. Sollte es im Nationalpark keine Möglichkeit geben, unser Zelt aufzubauen, würden wir uns für diese Nacht eine überdachte Unterkunft gönnen.
So gerade eben erwischen wir noch den Guarda Parque. Er drückt uns einen Schlüssel für das Tor in die Hand, ermahnt uns, ihn morgen Früh wieder abzuliefern und verabschiedet sich mit dem Hinweis, dass noch zwei andere Biker im Park zelten würden. Wir tippen auf die Pan Ams, Astrid und Daniel, und liegen damit nicht falsch. Die beiden hatten einen Tag vor uns den Torres del Paine verlassen.
Ihr Feuer prasselt bereits, und heißes Wasser für Tee steht griffbereit daneben. Die Wiedersehensfreude ist groß, und wir sitzen lange zusammen. Mit der Dunkelheit kommt jedoch die Kälte, und eine dünne Eisschicht legt sich über unsere Zelte. Es ist kalt an diesem Abend, lausig kalt.
Da wir von den Strapazen des Tages ziemlich ausgelaugt sind, gehen wir bald schlafen. Die Nacht wird ohnehin kurz werden, denn die Fähre nach Feuerland legt am morgigen Tag früh ab. Wollen wir mitfahren, müssen wir zeitig aufstehen.
Doch wir verschlafen und verpassen die Fähre. Wir hatten nämlich absichtlich keinen Wecker nach Südamerika mitgenommen. So müssen wir den Tag zwangsweise in Punta Arenas verbringen, was auf der anderen Seite gar nicht so schlecht ist. Denn mein Motorrad braucht dringend eine Inspektion. Da hierzu ein Tag aber viel zu knapp ist, muss die Schrauberei an der Ténéré noch bis Ushuaia warten. Ich kontrolliere lediglich die Schrauben, von denen sich bei der Rüttelei auf den Pisten viele gelockert haben.
Abends rufe ich noch einmal bei Anne an. Dieses Gespräch ist unserer letztes bis zum Wiedersehen in Ushuaia. Auch ich bin jetzt etwas nervös. Klappt alles wie geplant? Was ist, wenn der Flieger aus Deutschland Verspätung hat und Anne die Anschlussflüge nicht bekommt? Auch liegen die Flughäfen für nationale und internationale Flüge in Buenos Aires 30 Kilometer auseinander. Was ist, wenn Anne nicht in den richtigen Shuttle-Bus einsteigt? Kosmische Unbekannte, deren Einflussgröße niemand kennt.
Annes Nerven liegen ziemlich blank. Ihre Aufregung über die bevorstehende Reise ist enorm. Ich versuche, sie am Telefon so gut es geht zu beruhigen. Jedoch nur mit geringem Erfolg. Dieses letzte Telefonat macht mich doch etwas stutzig. So nervös habe ich meine Frau noch nie erlebt. Aber ich kenne Anne - irgendwie wird sie sich durchbeißen. Und in drei Tagen, da bin ich mir sicher, kann ich sie hier am Ende der Welt in meine Arme schließen.
Für uns geht es weiter nach Feuerland. Schon bei diesem Namen allein geht ein Schauer durch meinen Körper. Feuerland - das klingt nach Sturm, tobendem Meer, Finsternis und Kälte. So hat es zumindest Fernando de Magellanes beschrieben, als er im Jahr 1520 die 600 Kilometer lange Durchfahrt zwischen der Insel und dem Festland entdeckte. Da Fernando de Magellanes am Ufer zahlreiche Feuer sah, die von den Bewohnern der Insel, den Indianern, entzündet wurden, nannte er die Insel Feuerland.
Die ersten grimmigen Eindrücke des Entdeckers vor fast 500 Jahren bleiben uns - glücklicherweise - verschlossen. Die Magellanstraße zwischen Patagonien und der Isla Grande de Tierra del Fuego ist spiegelglatt. Heute Morgen sind wir zeitig genug aufgestanden, um die Fähre ja nicht nochmals zu verpassen. Und nun stehen wir abfahrtbereit am Hafen. Die Sonne scheint, und für hiesige Verhältnisse weht nur eine leichte Brise.
Am Kai in Punta Arenas ist der Teufel los. Es ist kurz vor Weihnachten, und Massen von Menschen fahren in die Ferien. Wir sind also mitten in die Hochsaison geraten. Und wieder müssen wir uns in Erinnerung rufen: Hier unten auf der Südhalbkugel ist jetzt Hochsommer.
Am Kai steht Max, ein kleiner Italiener mit einer zitronengelben BMW GS 1100. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass dieses Motorrad mindestens zwei Nummern zu groß für ihn ist. Gerade mal die Zehenspitzen erreichen den Boden, wenn er auf der Maschine sitzt. So kann er nur tippeln bei dem Versuch, die BMW so nah wie möglich an die Bordwand zu rangieren, damit sie richtig vertäut werden kann. Aber bitte - jeder so, wie er meint. Max hat alle Attribute eines Italieners. Er ist galant und charmant. Und diese Eigenschaften setzt er beim Flirten mit den weiblichen Passagieren gnadenlos ein.
Fast drei Stunden dauert die Überfahrt vom Festlandhafen Punta Arenas nach Porvenir auf Feuerland. Delfine sehen in der Fähre einen großen Spielkameraden und schwimmen in der Bugwelle, als wollten sie den alten Kahn zu einem Wettrennen animieren.
Porvenir heißt übersetzt »Zukunft« und ist das, was die Europäer ein verschlafenes Nest nennen würden. Doch für diese Region an der Südspitze Südamerikas ist der Ort mit seinen 5.000 Einwohnern eine Metropole. Früher war in Porvenir sogar richtig viel los. Doch die Goldsucher haben mittlerweile die Gegend verlassen, und auch die meisten der Schafzüchter haben aufgegeben. So fristet der Ort ein unauffälliges Dasein und hofft auf die Touristen, die von Punta Arenas kommen, um dann weiter nach Ushuaia zu fahren.
Porvenir war einmal die südlichste Stadt Chiles. Heute hat Puerto Williams auf der Insel Navarino diesen Titel inne. Der Ort liegt sogar noch weiter südlich als Ushuaia und damit auch näher an der Antarktis. Allerdings spielt Puerto Williams in touristischer Hinsicht keine große Rolle. Denn der auf der anderen Seite des Beagel-Kanals gelegene Ort ist nur schwer zu erreichen. Drei Tage Überfahrt - das erfordert eine Seetüchtigkeit, die über das normale Maß hinausgeht. Der Grund für die Existenz von Puerto Williams liegt eindeutig im militärischen Bereich. Es wird vermutet, dass im ewigen Kampf zwischen Chile und Argentinien die Chilenen einfach noch einen draufsetzen wollten, um für sich den Anspruch des südlichsten Ortes der Welt zu erheben.
Ankunft in Porvenir. Nach einer kurzen Pause, in der wir unsere Mägen mit Empanadas auffüllen, geht es weiter. Und oh Wunder: Zum ersten Mal haben wir hundertprozentigen Rückenwind. Was für eine Freude. Der Gasgriff ist kaum geöffnet, und ich rausche mit 80 Stundenkilometern über die Piste.
Max hat sich uns angeschlossen. Nun sind wir zusammen mit Astrid und Daniel schon sechs Feuerländer, deren Motorräder auf dem Schotter ganz schön viel Staub aufwirbeln. Wie es bei uns schon Tradition geworden ist, haben wir auch unserem neuen Mann einen Spitznamen verpasst. Da Max nach unserem Geschmack ein völlig untypischer italienischer Name ist, haben wir den Neuen kurzerhand in Luigi umbenannt - natürlich mit seinem Einverständnis.
Der starke Rückenwind weht uns zügig zur chilenisch-argentinische Grenze auf Feuerland. Aufgrund des starken Durchgangsverkehrs sind die Zöllner versiert in der Abfertigung ausländischer Fahrzeuge und Touristen. Nur der argentinische Beamte stöhnt unter der Last der Arbeit, sind doch sechs Motorräder auf einmal abzufertigen. Doch weder bei der Ausreise noch bei der Einreise dauert die Amtshandlung länger als zehn Minuten pro Maschine - ein neuer südamerikanischer Rekord.
Unmittelbar nach dem Grenzübergang beginnt der Asphalt, und wir können richtig Gas geben. Doch leider haben wir nun auch die Richtung gewechselt. Ab hier geht es nicht mehr nach Osten, sondern nach Süden. Das heißt, dass der Wind, der uns seit Porvenir kräftig angeschoben hat, nunmehr von der Seite bläst. Was uns auch auf geraden Strecken eine ziemliche Schräglage beschert.
Wir übernachten auf einem kleinen Zeltplatz etwa 180 Kilometer vor Ushuaia. Alle sind ganz schön nervös. Man kommt ja nicht alle Tage ans Ende der Welt. Wochen- oder monatelang hat man dieses Ziel vor Augen, und nun ist es plötzlich so weit. Die Nervosität ist auch Astrid und Daniel anzumerken. Seit mehr als einem Jahr sind sie unterwegs. Und nun haben sie ihr Ziel, das Ende der Panamericana, vor Augen.
Auch ich freue mich riesig auf die Stadt, ist sie doch eines der wichtigsten Ziele der gesamten Reise. Ein Ziel, von dem ich schon seit langer Zeit träume. Im Sattel meiner Ténéré konnte ich bereits vor einigen Jahren dem Nordkap, dem nördlichsten Punkt der Welt, der sich mit einem Fahrzeug erreichen lässt, einen Besuch abstatten. Und nun stehe ich kurz davor, den südlichsten Punkt der Welt zu erreichen.
Die letzten 100 Kilometer bis zur Stadt geht es noch einmal über Schotter. Dann ist es geschafft - ich stehe zusammen mit Birgit und Jo vor dem Ortsschild in Ushuaia. 31 Breitengrade habe ich auf dem Weg von den Iguazú-Wasserfällen bis nach Ushuaia überquert und dabei mehr als 10.000 Kilometer zurückgelegt. Was für ein Gefühl. Einfach Wahnsinn.
Doch die Realität holt mich schnell wieder ein. Wir wühlen uns durch die Stadt. Seit Comodoro Rivadavia haben wir keinen so hektischen Ort mehr erlebt. Ushuaia hat eigentlich nichts Schönes zu bieten. Vielmehr scheint diese Stadt einzig davon zu leben, der südlichste Punkt der Zivilisation und Stützpunkt für Reisen in die Antarktis zu sein. Im Hafen der Stadt sehen wir gleich mehrere Kreuzfahrtschiffe liegen, die Passagen ins ewige Eis anbieten.
Etwas verschreckt treten wir die Flucht in den Nationalpark Tierra del Fuego an, der 12 Kilometer südlich der Stadt liegt. In der Ruhe des Rio Pipo fühle ich mich sofort wesentlich wohler.
Nach dem Aufbau der Zelte ist es dann so weit. Wir machen uns auf, ans tatsächliche Ende der Welt zu fahren. Wir sind gespannt. Was erwartet uns dort? Doch das Ende erweist sich in Wirklichkeit als ein eher nüchterner Ort. Nichts ist von den tausenden von Abenteuern zu spüren, die all die Panamericana-Fahrer auf ihrem langen Weg von Alaska bis hierher erlebten. Nur ein schlichtes Schild, auf dem wir »Fin del Mundo« (Ende der Welt), »Buenos Aires - 3.063 km« und »Alaska - 17.848 km« lesen, weist darauf hin, wo man sich befindet.
So sieht es also aus, das Ende der Welt. Ein wenig enttäuschend. Auf den nicht enden wollenden Kilometern bis hierher habe ich mir in Gedanken einen spektakulären Ort vorgestellt. Doch nichts ist davon zu sehen. Auch der Wald aus Nummernschildern und Namenstafeln, der einst das südliche Ende der Panamericana zierte, ist verschwunden. Wie wir später erfahren, geschah das aus optischen Gründen. Die Kennzeichen passten nach Auffassung der Ranger nicht so recht ins Landschaftsbild eines Nationalparks und wurden entfernt. Schade. Ein wenig Abenteurer-Romantik hätte diesem Flecken Erde sicher nicht geschadet.
Viel Zeit, meinen Gedanken nachzuhängen, habe ich jedoch nicht. Es gibt eine Menge zu tun. Denn morgen kommt Anne an, und in zwei Tagen ist schließlich Weihnachten! Jedes Jahr um die Weihnachtszeit, so habe ich gelesen, soll am Ufer des Rio Pipo ein großes Traveller-Treffen stattfinden. Davon ist allerdings im Augenblick noch nicht viel zu spüren. Die »Pan Ams« und wir sind die einzigen Motorradfahrer, die hier zelten. Daneben haben sich noch eine Handvoll Abenteurer mit Geländewagen am Rio Pipo eingefunden.
Wir alle sind eine kleine Schar von Unentwegten, die dem Wetter trotzen. Denn die Witterung ist alles andere als angenehm - das Thermometer schafft es tagsüber nicht einmal, auf plus 5 Grad Celsius zu klettern. Am Ende der Welt ist es äußerst ungemütlich und saukalt. Dabei herrscht Hochsommer. Das Klima schlägt hier einen regelrechten Salto. Vergleicht man den Breitengrad von Ushuaia mit dem der nördlichen Halbkugel, so läge in diesen Breiten die Stadt Köln. Und dort kann man sich kaum eine Sommertemperatur am Gefrierpunkt vorstellen.
In der Nacht hat es geschneit. Auf den Bergen rund um den Rio Pipo liegt eine dünne Schneeschicht. Immer noch fallen vereinzelt ein paar Flocken, die weiße Pracht bleibt jedoch auf unserem Zeltplatz leider nicht liegen.