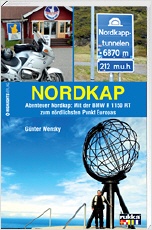Doppelpack - Leseprobe
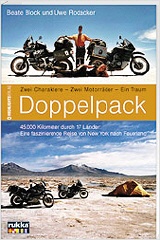
Kapitel 3: Zwei Mayas auf Motorrädern, von Beate Block
Es ist schwül im Dschungel um die Ruinen von Palenque. Über das Bergland geht kein Wind, und die Hitze der Tropen streift durch unsere Knochen. In den dunkelgrünen Bergen haben sich die fast 1.500 Jahre alten Tempel und Paläste versteckt, eingebettet in dichten Dschungel. Dies war ein Zeremonialzentrum der Mayas, und wie andere wichtige religiöse Stätten wurde auch Palenque um 900 verlassen – niemand weiß warum. Auf den Nebenwegen haben wir das Gefühl, Entdecker zu sein von kleinen Tempeln und kriegerischen Fresken.
Nachts brechen unsere Zeltstangen unter der Hitze. Dank unseres guten Schweizer Messers können wir sie reparieren. Ohne dieses Messer wären wir den Moskitos ausgeliefert gewesen. Die Hälfte der Nacht verbringen wir mit der Reparatur des Zeltes, in der zweiten Hälfte hält uns das Monster von Palenque wach, das unheimlich von den Bergen der toten Stadt herunterhallt, grunzt, brüllt und schnaubt. Dass das Brüllaffen sind, kleine niedliche Kreaturen, können wir kaum glauben.
Wir verlassen das Bergland und tauchen ein in Yukatan, in einen weiten, hellgrünen Dschungel mit langen Straßen, die in die Unendlichkeit des Grüns der Halbinsel zu verschwinden scheinen. In die so genannten Kurven kann man sich mit dem Motorrad nicht einmal richtig hineinlegen. Dahinter fällt der Blick wieder auf die graue, ins Mayaland eingefräste Straße. Auch die Mayas hatten Straßen. Sie bestanden aus buckligen weißen Steinen und führten quer durch dieses wasserarme Land.
In Uxmal ragt die Zaubererpyramide aus dem flachen Dschungel wie ein Vulkan aus den Wolken. Abends leuchtet die Ruinenstadt und lebt während einer Lichtshow wieder auf. Geschichten von den Stämmen der Uxmal und der Itza werden erzählt, die sich aufgrund einer schönen Prinzessin bekriegten. Die Stadt Uxmal war zwischen 600 und 900 n. Chr. eine wichtige Siedlung der Mayas und besaß mehrere Satellitenstädte.
Der hakennasige Regengott Chac ist allgegenwärtig in diesem Land, in dem es keine Flüsse gibt und wenig Regen fällt. An der Casa de las Tortugas, einem kleinen Tempel, krabbeln steinerne Schildkröten am Sims entlang. Neben einer Pyramide liegt unter einem trockenen Baum eine lebendige Schlange im Schatten, kaum sichtbar zwischen den gleichfarbigen Steinen. Ihr künstliches Pendant, eine gefiederte Schlange, das Sinnbild für den Gott Quetzalcoatl, windet sich durch die Steine an den Gebäuden. Wir klettern auf die Pyramide, entsteigen dem grünen Meer, um zu sehen, wie groß es ist. Es scheint unendlich. Kaum vorstellbar: Vor 1.000 Jahren war Yukatan fast so dicht besiedelt wie Deutschland heute.
Chichen Itza, die Hauptstadt der Mayas auf Yukatan, hat die schönste Pyramide, aber auch die meisten Touristen. Hier ist kein Entdeckergeist mehr möglich. Wir kraxeln die 365 Stufen hinauf, und als ich hinuntersehe, wird mir ganz anders, so steil ist es. Eigentlich ist die Pyramide ein gigantischer Kalender. Jede Stufe steht für einen Tag im Jahr, jede der 18 Terrassen für einen Monat im Maya-Kalender. Woher wussten diese Völker das alles so genau?
Auf dem größten Maya-Ballspielplatz Mexikos wurde mit einem Kautschukball gespielt, der durch einen hoch oben hängenden Steinring befördert werden musste. Unter den Tolteken wurde die Verlierermannschaft den Göttern geopfert.
Auch hier treffen wir wieder auf Chac, der uns angesichts der Hitze immer wichtiger erscheint. Nachts zieht der Vollmond neben der Pyramide auf, lässt sie magisch leuchten. Sie sieht verlassen aus, diese Pyramide, so verlassen wie die ganze Stadt im 9. und erneut im 14. Jahrhundert. Weshalb ihre Einwohner wegzogen, weiß niemand. Der Himmel sieht hier nachts anders aus: Der große Wagen verschwindet langsam am nördlichen Horizont, und seit ein paar Tagen sehen wir das Kreuz des Südens.
Bis Tulum, einer Maya-Festung direkt am karibischen Meer, ist es nicht weit. Wir fahren vorbei an Bambushütten, immer weiter. Die grauen Mauern der Festungsanlage wehren sich noch immer gegen jeden Eindringling, der aus der Ferne kommt, aber die Karibik leuchtet türkisblau und ist märchenhaft schön. Die Kriege sind hier schon lange vorbei.
Wir suchen Abenteuer an anderer Stelle: Auf einer Straße, die zu einer schmalen Landzunge nach Süden führt, wo der Straßenbelag aufhört, die Schlaglöcher immer größer werden. Sie haben bis zu fünf Meter Durchmesser, einen Meter Tiefe, sind mit Wasser gefüllt oder mit großen Steinen. Trockene Palmwedel peitschen über die Motorräder, mein Vorderreifen rutscht im Sand weg wie auf Schnee. Bei einem Stopp läuft uns der Schweiß aus den Ärmeln. Uwe lacht: »Das fühlt sich an wie in die Hose gepinkelt.« Das hat man eben von atmungsaktiver Kleidung in den Tropen: Da geht nichts rein, aber auch nichts raus.
Am Ende der 50 Kilometer langen und 40 Grad heißen Strecke erwartet uns nach drei Stunden Punto Allen: ein »laid-back«-Fischerörtchen par excellence. Wir campen am verlassenen karibischen Strand unter Palmen, trinken ein »Sol« – ein mexikanisches Bier – und fühlen uns wie echte Abenteurer.
Ein paar hundert Kilometer weiter bleiben wir in Xcalak, ziemlich relaxed in der Nebensaison. Das vorgelagerte Riff soll schön sein, aber es ist zu windig zum Schnorcheln oder Tauchen. Der Campingplatzbesitzer Alan erzählt uns, dass Xcalak, in dem heute nur ein paar hundert Leute wohnen, bis 1955 die größte Siedlung an der mexikanischen Karibikküste war, bevor es durch Hurrikan Janet vernichtet wurde. Letztes Jahr fanden die Einwohner am Strand dicke weiße Pakete, die wahrscheinlich von Drogenschiffen über Bord geworfen wurden, als die Küstenwache sich näherte. Alan war leider nicht schnell genug, aber seitdem gibt es nicht mehr nur zwei Motorroller im Dorf, sondern 30. Ja, was Drogen doch anrichten. Als Polizei und Militär kamen, war natürlich nichts mehr da von dem guten Stoff.
Wir streben immer in Richtung Süden. Als ich nach einer Pause an einer Tankstelle meine Jacke wieder anziehe, spüre ich plötzlich einen starken Schmerz an meinem linken Oberarm. Ich schreie, reiße die Jacke von meinem Körper, werfe sie auf den Boden, erwarte, dass etwas wespenartiges herausfliegt, da krabbelt ein schwarzer, glänzender, etwa zwölf Zentimeter großer Skorpion heraus. Ich stammele nur »Scorpio! Scorpio!« und erwarte, dass ich gleich mit Schaum vor dem Mund und Krämpfen zusammenbreche. Mein Arm schmerzt höllisch. Eine dicke Mexikanerin, die auf dem Weg zum Klo ist, erfasst die Situation mit einem Blick. Ein beherzter Schritt auf rosa Flipflops, ein Knirschen, und tot ist der Skorpion. »Sind die giftig?«, fragt Uwe, und sie lächelt: »Nein, in Mexiko gibt es keine giftigen Skorpione.« Ob sie denn in Deutschland giftig seien, fragt sie, und Uwe meint trocken: »In Deutschland gibt es keine Skorpione.«
Über eine halbe Stunde warte ich auf die tödlichen Symptome, aber außer Schmerzen wie nach einem Wespenstich passiert nichts. Was für ein Riesending, ich habe immer noch eine Gänsehaut vor lauter Ekel.
Da wir mal wieder einen Ölwechsel machen müssen, begeben wir uns in Chetumal auf die Suche nach einem Laden, der das passende Öl hat. Es ist eine echte Herausforderung, an die richtigen Ersatzteile heranzukommen. Man sieht hier auf den Straßen nur kleine 125er-Maschinen, die bestimmt auf keinen dicken 130-Millimeter-Reifen rollen. Und für einen Ölfilter muss man schon mal 500 Kilometer fahren. Wir haben festgestellt, dass nach Aussage der Menschen im jeweils nächsten Land alles besser wird. Die US-Amis sagten uns, dass in Mexiko massenhaft große Motorräder herumfahren würden, und die Mexikaner sind überzeugt, dass wir in Guatemala alle Ersatzteile leicht bekommen würden und das noch viel billiger. Wahrscheinlich aber werden wir uns die benötigten Teile im Dschungel aus Mayasteinen meißeln müssen.