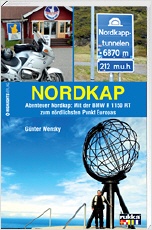Neuseeland pur - Leseprobe
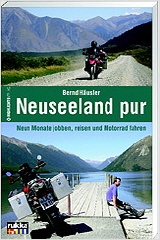
Kapitel 12: Spaß im BMW-Club
Lieber Hans,
die BMW hat sich mittlerweile an den Stadtverkehr gewöhnt, ihr Fahrer allerdings nicht. Irgendwann wird es passieren. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich meine diese verrückte und weltweit einmalige Vorfahrtsregel. Die wird mich irgendwann Kopf und Kragen kosten.
Also: Man fährt hier auf der linken Seite, so weit so gut. Daran habe ich mich gewöhnt. Gefährlich wird es beim Abbiegen nach links in eine Seitenstraße. Bei einem Land mit Linksverkehr entspricht das dem – zum Beispiel in Deutschland üblichen – ungefährlichen Abbiegen nach rechts. Man setzt den Blinker, kurzer Schulterblick wegen möglicher Radfahrer und Fußgänger auf der eigenen Spur, und man biegt ab. Der Gegenverkehr interessiert nicht. So lernt das jeder Fahrschüler in Deutschland. In Neuseeland auch, doch mit einer kleinen, aber feinen Ausnahme: Die Sache mit dem Gegenverkehr. Der hat nämlich Vorfahrt, sofern er in die gleiche Seitenstraße wie du selbst abbiegen will. Verrückt, aber es ist so. Die Begründung: Der Gegenverkehr habe schließlich den weiteren und damit gefährlicheren Weg zum Abbiegen. Die spinnen, die Kiwis!
Wenn du jetzt meinst, gewisse Verkehrsregeln seien das Einzige, was in Neuseeland Stirnrunzeln verursacht, hast du dich getäuscht. Es gibt nämlich noch den Bürokratie-Wahnsinn. Genau wie in Deutschland bemühen sich auch hier die Behörden, einem das Leben so schwer wie möglich zu machen.
Die Fakten: Wir haben bei Villa Maria eine eigene Werkstatt mit Schweißerei. Die Werkstatt ist das Reich von zwei Technikern, die für die Wartung der Abfüllanlage zuständig sind. Ich bin auch hin und wieder bei denen zu Gast, und sei es nur, um von Dave, einem Engländer mit ziemlich deftigem Humor, die neuesten Witze über Australier zu hören.
Streng genommen dürfte ich die Werkstatt jedoch nicht betreten. Am Eingang hängt nämlich ein riesiges Schild, auf dem ein wahrer Roman geschrieben ist: Nach Artikel soundso des Arbeitsschutzgesetzes sowieso darf dieser Raum nur betreten werden, wenn der Werkstattverantwortliche einen vorher über die Risiken und Gefahren, die hier lauern, aufgeklärt hat, man geeignete Schutzkleidung trägt, man die Broschüre »Arbeitssicherheit« ausgehändigt bekommen und vor allem gelesen hat, und so weiter. Ganz habe ich diesen Roman noch nie gelesen. Aber bestimmt steht da auch, dass man nur mit einer Rundumwarnleuchte auf dem Kopf und blauen Socken mit rosa Rüschen hinein darf. Oh Mann! Es handelt sich hier um eine stinknormale Werkstatt! Zur Ehrenrettung der Kiwi-Bürokraten sei gesagt, dass solche Auswüchse meist den gut gemeinten Hintergrund haben, Leib und Leben der Menschen zu schützen.
Jawoll, ich bin ein guter Deutscher! Warum? Weil ich das getan habe, was man als guter Deutscher tun muss: Ich bin einem Verein beigetreten, dem BMWOR. Der BMW Owners Register of New Zealand ist ein Motorradclub mit rund 600 Mitgliedern, die sich über das ganze Land verteilen. Eine lange Tradition gibt es auch – in diesem Jahr wurde 30-jähriges Bestehen gefeiert.
Auf Motorradtreffen in Deutschland schauen wir hübschen Mädels dabei zu, wie sie sich auf der Bühne aus ihren Klamotten schälen, wir machen Mofaweitwurf, hören laute Rockmusik und saufen, was das Zeug hält. Hier geht es etwas gesitteter zu, vor allem beim BMWOR. Das liegt vielleicht daran, dass BMW fahren eine ziemlich elitäre Sache ist und den reicheren Kiwis vorbehalten bleibt. Die Maschinen kosten einiges mehr als in Deutschland. Beim Treffen im Clubhaus in einem Industriegebiet tummeln sich deshalb viele Angehörige gehobener Berufsstände. Aber auch Enthusiasten, die vielleicht jahrelang für ihre BMW gespart haben und sie dann umso liebevoller hegen und pflegen. Alex ist so ein Enthusiast. Ein Deutscher, der mit seiner Frau das schöne Allgäu verlassen hat um sich in Neuseeland anzusiedeln. Endlich konnte ich mal wieder »schwäbisch schwätza«.
Auch sonst habe ich mich beim Treffen prima mit vielen Bikerinnen und Bikern unterhalten, die alle ganz Kiwi-like, unabhängig von Alter und Berufsstand, ausgesprochen nett und hilfsbereit sind. Ich freue mich schon auf gemeinsame Clubausfahrten und vor allem das Jahrestreffen des Clubs im Januar auf der Südinsel.
Noch immer bin ich in Kontakt mit Lehrern und Studenten der Sprachschule. So trifft man sich, um ins Kino oder etwas trinken zu gehen. Vor allem bin ich dadurch aber um eine triste Ein-Mann-Geburtstagsparty am anderen Ende der Welt herumgekommen. Mein Geburtstag fiel günstig auf einen Samstag, und ich hatte sturmfreie Bude. Also habe ich ordentlich den Kochlöffel geschwungen und Japaner, Koreaner, Schweizer und ein paar Kiwis zur Party mit original schwäbischen Maultaschen als Geburtstagsessen eingeladen.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Asiaten von der schwäbischen Spezialität wirklich angetan waren, aber der Wein von Villa Maria ist auf jeden Fall sehr gut angekommen. Außer Maultaschen, deren Name ich nicht so recht ins Englische übersetzen konnte, gab es noch andere landestypische Köstlichkeiten: Die Asiaten haben Sake, japanischen Reiswein, mitgebracht, von den Eidgenossen gabs Schweizer Schokolade, und ein paar Flaschen Weizenbier haben sie auch irgendwo aufgetrieben. Ich konnte noch gute, alte, aus dem Schwabenland mitgebrachte Volksmusik in voller Lautstärke beisteuern. Am »Sierra Madre«, dem Hit in jedem süddeutschen Bierzelt, muss allerdings noch dringend gearbeitet werden. Das hörte sich bei den Japanern zu sehr nach »Siella Madle« an.
Wir hatten also einen feuchtfröhlichen Abend, und ich am Tag danach meine liebe Mühe, das Haus wieder in seinen Originalzustand zurückzuversetzen. Ich konn?e es mir aber nicht verkneifen, Alyson ein paar Bilder von der Party nach Venedig zu mailen. Ihr Haus, so schrieb ich ihr, sei die perfekte Location für super Partys. Sie nahm es relativ locker und antwortete, es sei ziemlich bescheuert, eine Party im eigenen Haus zu verpassen.
Auf dem Weg zur Arbeit fahre ich täglich zunächst an der Küste entlang Richtung Zentrum, dort am Hafen vorbei nach Süden durch die Stadt, um dann kurz vor dem Ziel wieder am Meer entlang, diesmal ist’s der Waitemata Harbour, salzige Luft zu schnuppern. Und was man entlang der Küstengebiete sieht, ist immer wieder dasselbe: Segelboote, Segelboote und nochmals Segelboote. In keiner anderen Stadt der Welt gibt es so viele Segelboote pro Person wie in Auckland. Völlig zurecht daher Aucklands Spitzname »City of sails«. Westhaven Marina, zwischen Harbour Bridge und Containerhafen gelegen, ist mit rund 1.400 Bootsplätzen der größte Yachthafen auf der Südhalbkugel.
Noch vor 15 Jahren war dieses Hafenviertel eine heruntergekommene Gegend mit ziemlich üblem Ruf. Jetzt tummeln sich die Reichen und Schönen Aucklands in den schicken Bars und Restaurants rund ums Hafenviertel.
Der America’s Cup, die bekannteste Segelregatta der Welt, hat diesen rasanten Wandel ausgelöst. Sir Peter Blake konnte dieses sportliche Großereignis 1995 mit dem Skipper Russell Coutts erstmals für Neuseeland gewinnen. Das Land versank in einem kollektiven Freudentaumel. Im Jahr 2000 dann die Steigerung – der Cup wurde im eigenen Land, in Auckland verteidigt. Das Hafenviertel wurde zum America’s-Cup-Dorf auserkoren, was die rasante Veränderung vom Ghetto zum Schickimicki-Viertel auslöste.
2003 jedoch kochte der Volkszorn hoch: Man hatte sich den Cup vom Schweizer Team abjagen lassen. Ausgerechnet von den Schweizern, dieser großen Seefahrernation im Herzen der Alpen! Nicht dass man es ihnen nicht gegönnt hätte, wenn es denn tatsächlich Schweizer gewesen wären. Tatsächlich aber dachten die schwerreichen eidgenössischen Investoren nicht im Traum daran, Landratten aus dem eigenen Land ins 100 Millionen Euro teure Boot zu setzen. Sie legten daher noch ein paar große Scheine drauf und kauften dafür den Kiwi-Skipper Russell Coutts ein, der letztlich den Sieg für die Eidgenossen einfuhr. Jetzt muss er schauen, wo er die verdienten Millionen verprasst, der gute alte Russell. In Neuseeland kann er sich jedenfalls nicht mehr blicken lassen. Hier warten immer noch einige erhitzte Gemüter auf ihn, die ihn wegen dieses Landesverrats gerne teeren und federn würden.
Ich muss dir gestehen, dass ich etwas überheblich zu meiner ersten Ausfahrt mit den BMWOR-Leuten aufgebrochen bin. Viel Fahrspaß habe ich mir nicht davon versprochen. In einer Gruppe mit 15 Motorrädern würde der Gashahn sicherlich nicht allzu sehr aufgedreht, und die älteren Semester würden es genießen, gemächlich über die Lande zu tuckern. Dachte ich mir. Doch falsch gedacht. Diese Leute haben für eine Gruppenausfahrt ein verdammt hohes Tempo angeschlagen. Ein einschläferndes, monotones Fahren an einer festen Position in der Gruppe gibt es nämlich dank eines ausgeklügelten Rotiersystems nicht.
Es funktioniert so: Nur der Vorausfahrende bleibt immer der Vorausfahrende. Vorher festgelegt wird auch, wer das Schlusslicht bildet. Der ist aber nicht immer das Schlusslicht, sondern eher so etwas wie der Gejagte. Biegt der Führende irgendwo ab, so warte ich als Zweitplatzierter an der Stelle, wo abgebogen wird und weise allen Nachfolgenden den Weg. Wer als Letzter kommen muss weiß ich ja. Wenn der vorbei ist, kann ich die Aufholjagd starten, überhole den Letzten und reihe mich direkt vor ihm wieder ein.
Tolles System. So wird fleißig durchgewechselt, und es wird nie langweilig. Vor allem wenn man ganz hinten fährt, darf man ordentlich Gas geben, um den Fahrer zu schnappen, der als Letzter vorgesehen ist.
Es dauerte übrigens eine Zeitlang, bis die Kiwi-Biker dieses System dem begriffsstutzigen Deutschen halbwegs begreiflich machten konnten. Ich möchte sagen, schieben wir es einfach mal auf die Sprachprobleme.
Und noch etwas: Wenn ich gedacht habe, ich könnte hier jemanden mit meiner 1100er GS beeindrucken, so habe ich mich gewaltig getäuscht. Die neue 1200er ist seit kurzem auch in Neuseeland erhältlich, und einige Clubmitglieder sind schon mit diesem schicken Teil unterwegs.
Die Tour an sich war traumhaft. Wir waren auf kleinen Nebenstraßen südöstlich von Auckland unterwegs. Das sind hier noch nicht die traumhaft schönen Landschaften, wie man sie aus »Herr der Ringe« kennt. Schön ist es aber allemal. Bei dem zügigen Tempo waren wir locker zur Mittagspause an der Westküste in Raglan. Raglan ist ein Mekka für Surfer aus aller Welt. Die zehn Kilometer südlich von Raglan gelegene Whale’s Bay ist unter Surfern wegen ihrer links rollenden Dünung bekannt und beliebt. Was daran besonders ist? Keine Ahnung, aber die Surfer werden schon wissen, warum sie aus aller Welt hierher strömen. Vielleicht hat es mit dem liebenswerten Charme zu tun, den Raglan versprüht. Es ist ein ziemlich alternativ angehauchter Ort, in dem sich viele Künstler oder solche, die sich dafür halten, niedergelassen haben. Nach dem Mittagessen mit fangfrischem Meeresgetier in einem der malerischen Restaurants teilte sich die Gruppe auf. Ich schloss mich der »Schottertruppe« an, und wir schotterten über herrliche Offroad-Strecken R