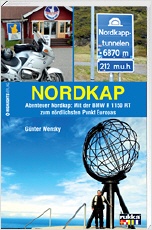Steppenreiter - Leseprobe
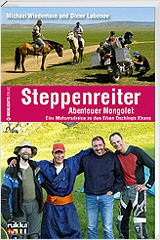
Kapitel 5
Erste Sonnenstrahlen locken mich aus dem Zelt. Eine Herde Pferde grast friedlich im Tal, in der Ferne werden Schafe von Nomaden zusammengetrieben. Ich muss erst mal meinen Rücken strecken. Zu Hause würde ich lieber 500 Kilometer zusätzlich fahren, nur um meiner Wirbelsäule nicht solch eine Nacht zuzumuten. Mein Bandscheibenvorfall vor zwei Jahren ist mir noch schmerzhaft in Erinnerung. In der Hauptstadt Ulaan Baatar soll die medizinische Versorgung schon sehr schlecht sein. Und erst hier draußen?
Nach und nach erscheinen zwei weitere verschlafene Gestalten auf der Bildfläche. Alle sind froh, dass die Nacht vorbei ist. Werner hat in seinem Zelt auf der Kuppe ausgehalten. „Viel geschlafen habe ich aber nicht“, sagt er. „Ständig ratterten irgendwelche losen Teile des Zeltes im Wind.“
Dieter packt seinen neuen Benzinkocher aus. Am Vergaser seines alten Boxers lassen sich die Schwimmerkammern ruck, zuck lösen. Zwei bis drei Füllungen Benzin verschwinden über einen kleinen Trichter im Bauch des Coleman. Etwas Druck aufpumpen, schon brennt die Flamme und liefert heißes Wasser. Ganz oben im Tankrucksack liegen die Kaffeepulvertüten aus der Tupolev. Schon ist der Morgenkaffee fertig. Moment! Wie war das? Ein Whisky am Morgen vertreibt Kummer und Magenprobleme? Dieter und ich nehmen einen Schraubverschluss voll, Werner lehnt dankend ab.
Als Tisch dient wieder der Deckel einer Alukiste an Dieters BMW. Die letzten Spuren des Abendbrotes hat der Regen der vergangenen Nacht abgewaschen. Frische Brötchen? Fehlanzeige. Als Frühstück ist Müsli mit Milchpulver eingeplant, entsprechend viele Tüten haben wir im Gepäck.
In einiger Entfernung reitet ein Mongole völlig entspannt über unseren Hügel. Ein kurzes Handzeichen von beiden Seiten ist die Begrüßung. Ich schaue ihm eine Weile nach. Kurze Zeit später habe ich den kleinen Punkt aus den Augen verloren. Mir dämmert die Erkenntnis, dass ein Pferd hier das ideale Fortbewegungsmittel zu sein scheint.
Das Zelt wird abgebaut und zusammen mit den restlichen Gepäckstücken den Hügel hinaufgetragen. Dieter hat das Bordwerkzeug ausgepackt. „Ich werde erst mal die Strebe höhersetzen. Gut, dass wir noch zusätzliche Löcher gebohrt haben.“ Jetzt ist der Strebe allerdings das Schutzblech im Weg. Zum Glück hat Werner ein Eisensägeblatt dabei. Was nicht passt, wird passend gemacht.
Den Motoren hat das Wetter nichts ausgemacht. Sie springen problemlos an. Vorsichtig lassen wir unsere „Packpferde“ ins Tal hinunterrollen. Der Untergrund hat das Regenwasser gut aufgenommen. Gerade als wir uns wieder auf dem Feldweg zurück zur Hauptpiste befinden, kommt das nächste Unwetter. Es regnet heftig, Blitze zucken, der Donner lässt die Luft vibrieren. Ich muss an das kleine Gewitter bei unserer Abreise auf dem Bahnsteig in Bünde denken. Hier draußen auf freier Pläne fühlt sich so etwas schon ganz anders an, hat etwas Bedrohliches. Die höchsten Punkte im Gelände sind wir auf den Motorrädern. Und die haben keine Blitzableiter.
Etwa 500 Meter neben der Straße steht ein Unterstand für Pferde. Wir fahren quer über die Wiese, durchqueren zum Schluss ein trockenes Bachbett und suchen Unterschlupf unter dem Holzdach. Das Wasser tropft durch alle Ritzen, der Platz vor dem Unterstand verwandelt sich langsam in eine große Pfütze. Das Gewitter zieht weiter ins Tal. Der Regen lässt mehr und mehr nach. Da fällt uns das ausgetrocknete Bachbett wieder ein. Wenn darin das gesamte Wasser der umliegenden Hügel zusammenfließt, sitzen wir in der Falle. Dieter macht einen Erkundungsgang und gibt Entwarnung: „Es ist zwar matschig, aber der Bach fließt noch nicht.“
Da wir in dem Stall sowieso nicht den ganzen Tag verbringen möchten, machen wir uns schleunigst auf den Weg. Es regnet nur noch leicht. Der Untergrund ist aufgeweicht. Am schrägen Hang der Wiese muss man mit der Gashand vorsichtig umgehen. Werner sucht uns eine fahrbare Passage zurück zum Weg. Der schlechte Feldweg von gestern ist nach dem Regen noch schlimmer geworden.
Einen Kilometer vor dem Owoo, den wir gestern so sträflich ignoriert haben, steigt der Weg steil an. Auf seiner ganzen Breite fällt er ebenso schräg ab wie der Hügel, an dessen Flanke er verläuft. Ständig versucht das Hinterrad, auf dem Matsch auszubrechen. Da gerate ich in eine vom Regen tief ausgewaschene Spurrille. Bevor ich reagieren kann, wirft mich die BMW ab. Ich falle hart auf den Rücken und ringe nach Luft. Die GS hat den Sturz unversehrt überstanden, sie ist auf den Sturzbügeln und den Alukoffern liegen geblieben. Nachdem ich wieder zu Atem gekommen bin, wird sie mit vereinten Kräften aufgerichtet. Ich fühle mich schlecht. So eine Schlammpiste ist nicht mein Ding. Was kann ich anders machen? Was kann ich besser machen bei solchen Streckenverhältnissen? Bis jetzt lasse ich mich von Werners hohem Tempo mitziehen. Vielleicht ein Fehler ...
Wir müssen weiter. Und so schlingern drei deutsche Motorradfahrer auf schlammigen Pisten irgendwo in der Steppe der Mongolei umher, in der Hoffnung, dass das Wetter sich bald wieder bessert und der Wind die Pisten trocken bläst.
Die Hügel haben wir geschafft. Jetzt geht es durch die Ebene zurück zur Hauptpiste. Wenn nur diese verdammten schlammigen Spurrillen nicht wären! Ich versuche es daneben auf dem durchgeweichten Acker. Es dauert nicht lange, und ich fliege wieder in den Dreck. Werner macht Fotos davon für die Nachwelt, während ich am Boden liege und mich mies fühle. Doch nicht nur meine Stimmung ist bereits am zweiten Tag ziemlich gedrückt. Regenwetter und Schlammpisten hatten wir uns für die ersten Tage in der Mongolei alle nicht gewünscht.
Ich bin ein reiner Asphaltfahrer. An diese Zustände muss ich mich erst einmal gewöhnen. Aber wie? Nach jedem Sturz fühle ich mich unsicherer. Also fahre ich hinter dem offroaderfahrenen Werner her. Werner legt mir sozusagen eine Spur, und ich achte darauf, was der „Profi“ vor mir macht: Gewicht nach hinten verlagern, das Vorderrad entlasten und laufen lassen, sanft Gas geben, tiefe Längsrillen vermeiden und mit einem beherzten Gasstoß die zahlreichen kleinen Flüsse queren, die gestern noch nicht da waren. Werners Hinterrad tänzelt vor mir, und ich lerne tatsächlich mit jedem Kilometer dazu. Trotzdem ist meine Stimmung auf dem Nullpunkt. Hatte ich mich doch auf Sonne und Spaß im Gelände in einem der sonnenreichsten Länder der Welt eingestellt.
Kurz bevor wir wieder an der Kreuzung ankommen, an der es links Richtung Karakorum geht, gehe ich im knöcheltiefen Schlamm ein drittes Mal zu Boden. Zum Glück nur ein sanfter Ausrutscher. Ich sehe aus, als hätte ich im Schlamm gebadet. Da hilft nur Galgenhumor: „Langsam macht sogar das Hinfallen Spaß“, kommentiere ich das Malheur.
Werner gibt uns zu verstehen, dass wir heute noch 90 Kilometer bis Lun schaffen sollten. Spinnt der? Jetzt werde ich sauer: „Ich bin auf 20 Kilometern dreimal auf die Schnauze geflogen. Das macht im Schnitt alle sieben Kilometer einen Sturz. Vergiss’ es! Bei diesen Wetterverhältnissen fahre ich heute sicher nicht mehr bis Lun!“
Dieter sieht die Sache ebenso. Wir sind inzwischen alle völlig durchgeweicht. Und jetzt?
In der Ferne ist vor der Hügelkette auf der anderen Seite des Tales ein Ger-Camp auszumachen. Aber wie dort hinkommen? Die Baustellenstraße muss überwunden werden, das Tal dahinter sieht bei dem Regen wie eine riesige Matschpfütze aus. Aber was hilft’s? Es muss sein. Zuerst suchen wir nach einer Auffahrt auf die Baustelle. Irgendwo müssen doch die schweren Baumaschinen auf die Trasse kommen. Werner fährt voraus. Mit reichlich Schwung saust er die Böschung der Trasse hoch. Ich traue meinen Augen nicht: Da soll ich hinauf? Ich nehme mir ein Herz und schieße hinter Werner her. Und – es klappt. Jetzt nur noch auf der anderen Seite die Trasse hinunter und das Tal durchqueren. Geschätzte drei Kilometer ist das Camp entfernt. Das sollte zu schaffen sein. Nur drei Kilometer. Ein Ger, ein trockener Platz am warmen Ofen – sie locken jetzt drei durchnässte Abenteurer.